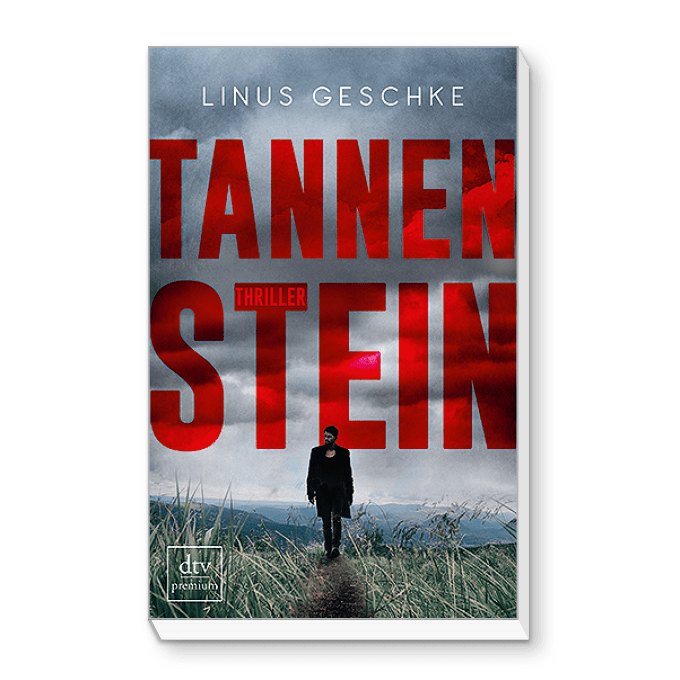Auch als eBook auf hugendubel.de erhältlich
 159 Lesepunkte sammeln
159 Lesepunkte sammeln
Der Mann will es genau wissen. Er sucht den Kick. Wo ist die Grenze? Und was, wenn man sich weiter wagt? Das testet Linus Geschke nicht nur beim Tauchen aus, sondern vor allem als Autor von Thrillern. Zum Auftakt seiner neuen Trilogie spielt der Kölner mit internationalem Horizont als Journalist souverän seine Stärken aus – von der Atmosphäre der Schauplätze bis zu den vielschichtigen Protagonisten, die sich selbst nicht geheuer sind. Raffiniert inszenierte Spannung!
Als Sie letzten Herbst Ihren neuen Thriller „Tannenstein“ vollendet hatten, lautete Ihr Post: „Das wird ein Brett!“ Was ging Ihnen da durch den Kopf?
„Tannenstein“ ist kein moralisches Buch, aber eines über Moral. Eine Geschichte, die Fragen aufwirft. Rache ist ein Thema, das verstört – die Leserinnen und Leser sollen für sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.
Im Schlusswort zu „Tannenstein“ berichten Sie, dass Sie dieses Buch dringender schreiben wollten als alle anderen. Was war Ihr Antrieb?
„Tannenstein“ ist der Thriller, den ich immer lesen wollte, in dieser Form aber viel zu selten gefunden habe. Kein überkonstruiertes Kammerspiel und kein durchgeknallter Serienmörder, der nach dem Vorbild nordischer Gottheiten mordet. Ich wollte eine Geschichte, die mit einem Paukenschlag beginnt und bis zum Ende nicht mehr vom Gas geht – getrieben von der Frage, was die Guten alles tun können, bevor sie durch ihre Handlungen selbst zu den Bösen werden.
Bekannt geworden sind Sie als Autor von Spannungsliteratur mit Ihrer Reihe über ihren fiktiven Kollegen Jan Römer, der als Journalist ein Faible und viel Spürsinn für ungeklärte Kriminalfälle entwickelt. Was macht die Faszination aus?
Wer war Jack the Ripper? Wer steckte hinter der Maske des Zodiac-Killers? Gab es eine Kennedy-Verschwörung? Mich haben solche Fragen schon immer fasziniert. Deshalb haben sie auch eine zentrale Bedeutung in meinen Büchern, verbunden mit der Hoffnung, dass es den Leserinnen und Lesern genauso ergeht.
Ein absolut rätselhafter, drei Jahre alter Fall liegt auch Ihrem neuen Thriller „Tannenstein“ zugrunde. Hatten Sie einen realen Fall als Vorbild? Oder was war Ihr Motiv als Autor für dieses Massaker?
Nein, die Handlung ist frei erfunden. Keine Aufarbeitung eines realen Falls. Die Motivation entsprang einzig dem Bestreben, gute Unterhaltung zu bieten.
Recherche gehört zum alltäglichen Handwerk für Sie als Journalist und auch als Thrillerautor. Mit welchem Anspruch haben Sie sich an die Arbeit an „Tannenstein“ gemacht?
Auch, wenn eine Story fiktiv ist, muss sie realistisch sein. Ich mag Geschichten, die sich in der Wirklichkeit genau so hätten abspielen können – selbst, wenn sie nur in meinem Kopf entstanden sind.
Der Rechercheradius muss riesig gewesen sein. Wo waren Sie unterwegs? Was war am spannendsten?
Jeden der Handlungsorte habe ich besucht, mit vielen Menschen gesprochen. Die Begegnung, die alle anderen überstrahlte, war jene mit „Igor“. Der Kriegsveteran hatte viel zu sagen über die Denke und Handlungsweisen der „GRU SpezNas“, einer besonderen Einheit des russischen Geheimdienstes.
Sind Sie durch den Grunewald gestreift, um zu ergründen, wo einer Ihrer gefallenen Helden am geschicktesten seine Pistole vergraben könnte?
Ehrlich gesagt, nein. Ich brauchte einen prägnanten Punkt und habe den Monolithen an die Stelle versetzt, an der er mir am passendsten erschien.
Mit den Handlungsorten nehmen Sie es ansonsten ziemlich genau. Wie gehen Sie vor bei der Suche nach den perfekten Kulissen?
Es gibt helle und dunkle Orte, laute und leise. Namen, mit denen man etwas verbindet. Beides muss zu der Geschichte passen und die Stimmung liefern, die die Story unterfüttert. Stellen Sie sich einen grausamen Doppelmord vor, begangen in einem runtergekommenen Trailer-Park in Alabama – das wirkt ganz anders, als wenn die Kulisse ein Schrebergarten in Wanne-Eickel wäre.
Leichen pflastern meinen Weg, lautet eine Zwischenbilanz Ihrer Reportage über die Suche nach dem perfekten Schauplatz. Was war da los? Und war das auch ein Argument gegen Ihre Heimatstadt Köln als Kulisse?
Köln ist in den Augen vieler Menschen vor allem Karneval, der Dom und der 1. FC Köln. Kein Ort, an dem ich mir eine Figur wie die Hauptperson Alexander Born vorstellen konnte. Er brauchte eine andere Stadt, deutlich ambivalenter, die viele unterschiedliche Strömungen abdeckt. Das konnte nur Berlin sein.
Mit dem Ort Tannenstein muss es etwas ganz Besonderes auf sich haben. Was genau? Wozu führt es, 30 Kilometer südlich von Dresden auf der Landkarte zu suchen?
Es ist eine herrliche Gegend, landschaftlich wunderschön. Gleichzeitig hat sie aber auch etwas Dunkles, Zurückgelassenes. Kleine Dörfer mit verborgenen Geschichten, die nicht nach außen dringen. Genau hier, inmitten eines abgeschiedenen Tals, musste Tannenstein liegen.
Vor allem am Anfang kommt einem „Tannenstein“ vor wie ein großer Kameraschwenk nach dem anderen – mit einem Panorama von Berlin-Tegel bis in die Weite Russlands. Worum ging es Ihnen dabei?
Manche Geschichten brauchen Raum, außerden werden Menschen von Orten geprägt. Mir wäre es einfach falsch vorgekommen, wenn alle Protagonisten einem räumlich begrenzten Gebiet entstammen würden.
Im bitterkalten russischen Winter lassen Sie in der Nähe der Wolga-Metropole Nischni Nowgorod zwei Veteranen des Tschtschenien-Kriegs aus einem See auftauchen. Was macht diese und ähnliche schlaglichtartige Szenen wichtig?
Die Szene ist nur kurz, aber wichtig, weil sie viel über die Zwillinge verrät. Wie Sie richtig formulieren: Ein Schlaglicht, aber eines, das im Kopf bleibt. Es erzeugt eine Stimmung, vermittelt ein Gefühl, lässt die Leserinnen und Leser zu Beobachtern werden. Ich will ihnen in solchen Momenten nur zeigen, was passiert, die Meinung darüber sollen sie sich selbst bilden.
Bei Tschetschenien denkt man unwillkürlich an den großen US-Fotografen Stanley Green und seine eindringlichen Kriegsbilder. „Wir müssen Botschafter der Wahrheit sein“, so sein journalistisches Selbstverständnis. Und Ihres?
Das trifft es ziemlich gut, und es sollte allgemeingültig sein und für jeden Menschen gelten.
Green war einer jener Journalisten, die sich in den Kugelhagel begeben, um möglichst unmittelbar das Geschehen zu vermitteln, hieß es. Wie lässt sich Ihre bevorzugte Perspektive beschreiben?
Vielleicht so: Wenn du in einer Bar bist, werde zu Holz. Am Meer zu Wasser. Je weniger dich die Menschen, an denen du interessiert bist, als Journalist wahrnehmen, um so natürlicher geben sie sich.
Weil wir schon am Wasser sind: Sie schreiben auch Bücher übers Tauchen. Welchen Bedeutung hat es für Sie? Entspannung vom Schreibtisch? Oder – im Gegenteil – Live-Abenteuer und Ausloten der eigenen Grenzen?
Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt und Tauchen bietet die beste Möglichkeit, diese Welt zu entdecken und eins mit der Umgebung zu werden. Außerdem ist es die perfekte Mischung aus Adrenalin und Entspannung, aus Ruhe und Erlebnis.
„Tannenstein“ beginnt im gleichnamigen Ort – mit der Ankunft eines geheimnisvollen Mannes, der ein Massaker anrichtet. Was ist Ihnen bei diesem undurchschaubaren Typen wichtig?
Vor allem seine Beweggründe. Man muss ihn nicht lieben und nicht akzeptieren, was er tut, aber das „Warum?“ verstehen. Im weiteren Verlauf bekommt die Figur immer mehr Tiefe, werden seine Handlungen schlüssiger und nachvollziehbarer. Außerdem habe ich ein Faible für undurchschaubare Figuren: eindimensionale Typen langweilen mich eher.
Der zweite Einzelgänger ist Alexander Born, einst ein hervorragender Ermittler – mit Doppelleben. Auch seine Beweggründe beschäftigen Sie sehr, oder?
Natürlich, und das hat viel mit dem bereits angesprochenen Realismus zu tun. Ich kann nicht mit einem Protagonisten mitgehen, dessen Charakter oberflächlich bleibt. Keine seiner Handlungen darf aus dem Nichts entstehen, sie muss immer eine Folge der vorherigen sein.
Was ist für Sie die spannendste Frage beim Planen und Schreiben von „Tannenstein“ gewesen? Die Motive der Einzelnen, Grenzen zu überschreiten oder sogar über Leichen zu gehen?
Jede der Hauptfiguren hat gute Gründe für ihr Tun. Von ihrem Standpunkt aus, aus ihrer Welt betrachtet, handeln sie so, wie es ihnen richtig erscheint. Jeder Mensch hat Grenzen, aber dann mag es Situationen geben, in denen man diese verschiebt. Immer weiter, immer ein Stückchen mehr, bis man auf einer Seite steht, auf die man nie wollte. Die spannendste Frage für mich als Autor war, ob es mir gelingt, dies den Leserinnen und Lesern glaubhaft zu vermitteln.
„Tannenstein“ als Doppelpsychogramm und zugleich als Duell auf Augenhöhe von Ex-Kommissar Alexander Born und dem Wanderer – eine schlüssige Interpretation?
Das trifft es ziemlich gut. Es ist fast schon ein Dreierpsychogramm, wenn man die Russen noch hinzunimmt. Alle hatten ähnliche Lebenslinien, die sich dann aber vollkommen unterschiedlich entwickelt haben.
Die dritte im Bund ist Norah Bernsen, Kommissarin in der Karriere-Sackgasse. Warum sollte man sie nicht unterschätzen?
„Tannenstein“ ist der Auftakt zu einer Trilogie – und Norah die Figur, die sich in deren Verlauf am stärksten entwickeln wird. Eine starke Frau, die sich ihrer eigenen Fähigkeiten anfangs noch nicht bewusst ist. Trotz der harten Typen um sie herum ist sie beim Schreiben immer mehr zu meiner Lieblingsfigur geworden.
Und Sie selbst? Neigen Sie auch dazu, es sich und der Welt beweisen zu wollen? Grenzen auszutesten?
Oh je, das ist eine gute Frage … Vielleicht ja, ein bisschen. Die Aussage „Das darfst du nicht!“ hatte schon immer einen Reiz, dem ich nur schwer widerstehen kann.
Wie Alexander Born Filterkaffee aus der Thermoskanne oder doch lieber erlesenen Espresso vom hippsten Barista weit und breit?
Ganz normaler Kaffee mit einer schönen Crema und ein wenig Milch dazu – passt!
Auf Nummer sicher geht keine Ihrer Hauptfiguren in Tannenstein, aber welche literarische Zukunft haben denn die Überlebenden?
Sie werden im zweiten Band wieder aufeinandertreffen. Ihre Stellung zueinander wird sich ändern, die Umstände ebenso. Ich will nicht zu viel verraten, aber manche Figur, die man jetzt noch hasst, wird man vielleicht lieben lernen.
Haben Sie am Ende mit „Das Schweigen der Lämmer“ geflirtet?
Gibt´s da wirklich eine Parallele? Wenn ja, sollte ich Thomas Harris‘ Meisterwerk unbedingt noch einmal lesen!