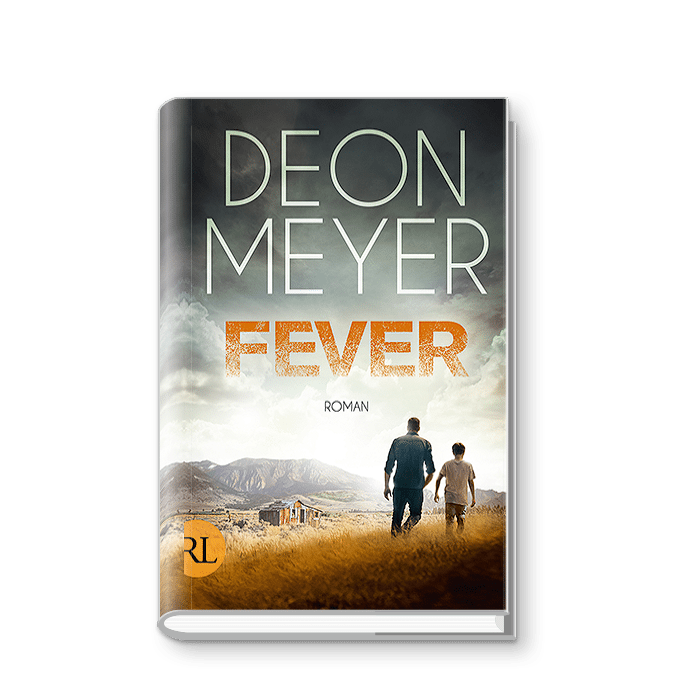Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 200 Lesepunkte sammeln
200 Lesepunkte sammeln
FORMAT BEWEIST Deon Meyer nicht nur durch eindrucksvolle 1,90 Meter Körpergröße und seine Rugby-Statur, sondern vor allem als Schriftsteller. 1958 in der Weinregion bei Kapstadt geboren, hat er sein Handwerk von der Pike auf gelernt und sein Schreibtalent zunächst als Reporter genutzt. Meyer gilt als Gründer der südafrikanischen Kriminalliteratur und zählt längst auch international zu den Stars. Sein neuer Roman „Fever“ vereint Thrillerspannung mit Dystopie und Utopie. Kein Widerspruch bei Deon Meyer, der ja auch seine Motorrad-Leidenschaft mit Mozart-Verehrung unter einen Helm bringt.
Sie werden als „Easy Rider der südafrikanischen Literaturszene“ bezeichnet. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Meine Motorradkumpel fanden meine Begeisterung für Mozart zunächst ziemlich seltsam. Aber noch irritierender fanden sie die Tatsache, dass ich so wenig Alkohol trinke. Es dauerte lange, bis sie mir vertrauten. Wie auch immer – mein Motorrad habe ich vor drei Jahren verkauft. Vielleicht könnte man mich folgendermaßen beschreiben: Ich bin ein 59-jähriger Mountainbike-Fahrer und mozartliebender Rugby-Fan, der Romane schreibt und gerne Reisen mit seiner schönen Frau unternimmt.
Für Sie ist es „eine Frage der Ehre“, alle Orte zu besuchen, bevor Sie darüber schreiben. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Nun, als mein erster – übrigens nicht ins Deutsche übersetzter – Roman erschienen war, bekam ich Leserbriefe, in denen ich als Idiot bezeichnet wurde. Und das nur, weil ich ein paar Dinge über Wein und Geografie nicht ganz korrekt dargestellt hatte. Ich gelte aber nicht gern als Idiot. Darum nehme ich es mit meinen Recherchen seither ganz genau.
Auf Ihrer Homepage versetzen Sie uns in die Welt Ihres neuen Romans „Fever“, z.B. mit Fotos von den Schauplätzen. Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgewählt?
Das einzige Kriterium war die Glaubwürdigkeit. Ich musste also die beste Gegend in Südafrika finden, wo nach der Fieber-Apokalypse eine Gesellschaft einen neuen Anfang machen konnte. Ich versuchte das im Hinblick auf Ernährung, Wohnen, Sicherheit usw. zu durchdenken. Und als mir klar wurde, dass Vanderkloof am Oranje-Fluss dafür wohl am besten geeignet war, fuhr ich hin, um es mir genauer anzusehen. Es ist ein eigenartiger kleiner Ort, vom Wetter mitgenommen und ein bisschen unheimlich – einfach perfekt.
Ihr neuer Roman „Fever“ ist kein konventioneller Thriller. Wie würden Sie die literarische Herausforderung auf den Punkt bringen, der Sie sich mit „Fever“ gestellt haben?
Als ich an „Fever“ zu schreiben begann, hatte ich einen Romananfang und einen Schluss. Sonst nichts. Die größte Herausforderung, in literarischer Hinsicht und auch sonst, war es, für die riesige Lücke dazwischen die bestmögliche Geschichte zu finden. Grundideen und Fragen hatte ich jede Menge: Sind wir gut oder böse? Was bestimmt darüber, ob wir gut oder böse sind? Ist das angeboren oder durch unsere Umgebung bestimmt? Ist es für unseren Planeten schon zu spät? Was würde auf der Welt passieren, wenn wir einen Neuanfang machen könnten – ohne jede Ungleichheit?
„Sind wir gut oder böse?“
Der Titel „Fever“ steht für eine verheerende Epidemie. Worum geht es Ihnen bei diesem Katastrophenszenario?
Für die Geschichte, die mir vorschwebte, brauchte ich einen Planeten mit intakter Infrastruktur und intakten Ressourcen, aber mit 95 Prozent weniger Menschen. Eine Virusepidemie schien da eine elegante Lösung. Ich hatte das Privileg, dass zwei hervorragende und höchst angesehene Virologen eigens einen Virus für mich erfanden: Professor Wolfgang Preiser, Leiter der Abteilung für Medizinische Virologie am Pathologischen Institut der Universität Stellenbosch, und Professor Richard Tedder vom University College London. Ihr fiktiver Virus für meinen Roman beruht auf einem Hybrid des Corona-Virus.
Sie datieren den Zeitpunkt der Fieberepidemie nicht genau und geben keine Jahreszahl an. Warum haben Sie auf eine genaue zeitliche Einordnung verzichtet? Und wie kamen Sie auf die Idee, als eine Art Zeitangabe den BVB-Trainer Thomas Tuchel ins Spiel zu bringen? Sind Sie nicht nur Rugby-Fan, sondern auch Fußball-Fan?
Wenn ich die Fieberepidemie genau datiert hätte, wäre damit auch das Buch selber automatisch auf ein bestimmtes Jahr festgelegt gewesen. Da es aber in verschiedenen Sprachen zu ganz verschiedenen Zeiten erscheint – manchmal liegen Jahre dazwischen – wäre das keine gute Idee gewesen. Das internationale Fußballgeschehen verfolge ich ein wenig. Ich muss gestehen, dass ich ein Fan des BVB und von Tuchel bin. Allerdings auch ein Fan von Barcelona …
Nico Storm, aus dessen Perspektive Sie „Fever“ erzählen“, nennt das Ganze seine „Memoiren“. Was fanden Sie am Memoirenschreiben spannend?
Ich habe keine Erfahrung darin, echte, durch und durch ehrliche Memoiren zu schreiben. Und ich werde sie auch nie haben. Dafür war mein Leben einfach nicht aufregend genug.
Der Mann, der in Ihrem Roman alles ins Rollen bringt, ist Nicos Vater Willem Storm. Er hat eine große Vision. Ist dieser Gesellschaftsentwurf auch Ihre Vision?
Ja! Es ist die Vision einer neuen Gesellschaft der Gleichheit – klassenlos, ohne Grenzen und ohne Nationen. Willem Storm begründet nicht nur die Ansiedlung Amanzi, sondern auch das Amanzi-Geschichtsprojekt mit Porträts von Bewohnern in den Gründerjahren.
Was macht dieses Projekt so wichtig?
Für Willem war es sehr wichtig, künftigen Generationen zu vermitteln, woher sie kamen. Und für mich war es eine großartige Möglichkeit, die Geschichte der neuen Gesellschaft vielschichtiger zu erzählen, ohne mich zu wiederholen oder vorhersagbar zu werden.
Das Dorf Amanzi wächst schnell und Sie lassen die Bewohner und deren Lebensgeschichten mit Höhen und Tiefen lebendig werden. Hatten Sie für diese lebendigen Charaktere Vorbilder?
Nein, ich verwende nie Vorbilder. Worauf es mir ankam? Nun, meine ganze Hoffnung bestand darin, die Geschichte so unterhaltsam und glaubwürdig zu machen, wie ich konnte.
Am Anfang ist Nico 13 und sein Vater der große Held für ihn. Aber dieses Bild bröckelt und ein neuer Held taucht auf, der eine ganz andere Weltsicht und ganz andere Werte verkörpert und lebt. Worum geht es ihnen dabei?
Ich wollte die Geschichte von Nicos Erwachsenwerden so glaubwürdig und fesselnd wie möglich erzählen. Und zum Erwachsenwerden gehört der ständige Prozess der Desillusionierung, was Helden angeht. Das betrifft meistens auch die eigenen Eltern.
Wie würden Sie die Sprachwelt beschreiben, in der Sie leben? Welchen Grund hat Ihre Entscheidung, auf Afrikaans zu schreiben statt auf Englisch?
Romane zu schreiben, ist mühsam genug. Deshalb schreibe ich in der Sprache, die ich am besten kann: Afrikaans, meine Muttersprache. Es fällt mir schwer, meine Sprachwelt zu beschreiben: Sie ist, was sie ist. Ich lebe in einem multikulturellen, vielsprachigen Land und in einer ebensolchen Umgebung – und ich fühle mich wohl so, bin hier glücklich und zufrieden. Für mich ist es, wie es sein sollte. Und es ist interessant und aufregend.