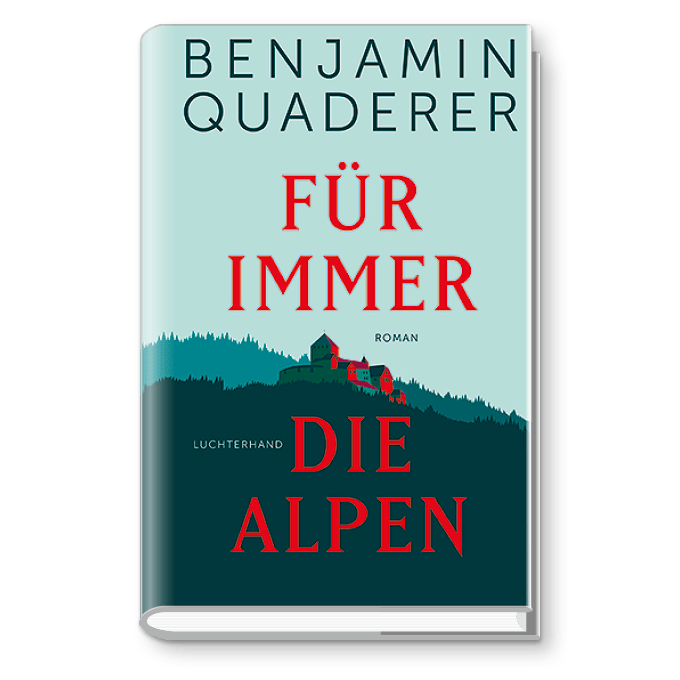Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 220 Lesepunkte sammeln
220 Lesepunkte sammeln
2008: DER SKANDAL! Ein Liechtensteiner verhökert Kundendaten an den deutschen BND und löst damit eine gewaltige Lawine aus. Und Benjamin Quaderer, damals in Wien Literarisches Schreiben studierend, hatte seinen Stoff gefunden. Für das erste Kapitel seines Debütromans wurde er beim „open mike“ ausgezeichnet – einem der wichtigsten Literatur-Wettbewerbe für Neuentdeckungen. So bestärkt, schrieb er gottlob weiter. Einen tollkühnen Roman über die Macht des Geldes, aber vor allem auch die Macht des Erzählens!
In einem Blog war 2016 zu lesen: „Benjamin Quaderer ist ein Exot.“ Wie zutreffend finden Sie diese Einordnung in Anspielung auf Ihre Herkunft aus Liechtenstein?
Hans-Jörg Rheinberger, ein Liechtensteiner Wissenschaftshistoriker, hat einmal gesagt: „Wenn man aus einem kleinen Land stammt, ist man so gut wie überall auf der Welt im Ausland. Man ist gewissermaßen – ein verschwindendes Ereignis.“ Das gefällt mir sehr viel besser.
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie aus der Ferne zurückdenken an Ihre Kindheit und Jugend in Liechtenstein?
Ein Sonntagabend im späten Sommer, überall riecht es nach Grillfleisch, die Kirchglocke schlägt, und von irgendwo her singt Dirk von Lowtzow: „und alles was wir hassen / seit dem ersten Tag / wird uns niemals verlassen / weil man es eigentlich ja mag“.
„… so winzig und trotzdem ein Staat.“
Was macht Liechtenstein zum perfekten Roman-Epizentrum?
Dass es so winzig ist und trotzdem ein Staat. Was winzig ist, lässt sich gut überblicken, und was Staat ist, muss mit anderen Dingen, die auch Staat sind, verglichen werden können. Liechtenstein ist wie ein Modell, das im Kleinen zeigt, wie das Große-Ganze funktioniert. Zumindest bilde ich mir das ein.
Und worin sehen Sie Liechtensteins Thrillerpotenzial?
In dem, was lange Zeit sein Geschäftsmodell gewesen ist: in den Stiftungen, in den Banken, in den Finanzströmen aus aller Welt, die nach Liechtenstein fließen und dort verschwinden.
Ihr Roman ist die Geschichte einer gewaltigen Lawine. Welche Ausgangsidee brachte alles ins Rollen?
Der Text oder besser die Figur Johann Kaisers basiert auf der Biografie von Liechtensteins realem Staatsfeind Nummer 1, Heinrich Kieber, der bei einer Liechtensteiner Bank Kundendaten geklaut und diese 2008 an den Bundesnachrichtendienst verkauft hat. Ich habe diese Geschehnisse damals in Echtzeit verfolgt – 2008 war das Jahr, in dem ich Liechtenstein verlassen habe, um in Wien zu studieren –, doch wie unglaublich das alles ist, ist mir erst später bewusst geworden. Mein Plan war dann ursprünglich, dass die fiktionalisierte Geschichte des Datendiebs lediglich ein Strang eines riesigen Liechtenstein-Romans werden sollte, aber Gottseidank habe ich irgendwann festgestellt, dass dieser Plan kompletter Blödsinn ist und sich alles, was ich erzählen möchte, über die Figur Johann Kaisers erzählen lässt.
„Staatsfeind Nummer 1“
Was besiegelt das Schicksal Ihres Protagonisten Johann Kaiser?
Zum Zeitpunkt des Erzählens befindet sich Johann Kaiser in einem Zeugenschutzprogramm und blickt von dort aus auf sein Leben zurück. Das heißt, er erlebt die Sachen nicht unmittelbar, sondern beschreibt alles im Nachhinein. Ich weiß von mir selbst, dass ich dazu neige, Geschichten aus meiner Vergangenheit zu dramatisieren und etwas gewichtiger zu machen, als sie eigentlich waren. Ich glaube, so geht es Johann auch. Man weiß bei ihm nie so genau. Deshalb würde ich sicherheitshalber sagen: Derjenige, der Johann Kaisers Schicksal besiegelt, ist Johann Kaiser selbst.
Ein Protagonist, der schon als Neugeborener durch seine markerschütternde Stimme eine Bedrohung für Fensterscheiben darstellt, weckt unweigerlich Assoziationen zu Oskar Matzerath. Inwiefern liegen wir da richtig?
Als ich zum ersten Mal aus dem Text vorgelesen habe – das war 2016 beim open mike –, wurde mir von mehreren Leuten gesagt, Johann Kaiser erinnere sie an Oskar Matzerath. Das war vor allem deswegen interessant, weil ich die Blechtrommel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gelesen hatte. Das habe ich dann aber sofort nachgeholt. Und ja, ich verstehe den Vergleich, eine unmittelbare Vorlage war Oskar Matzerath aber nicht.
Von anderen Kindern wird Johann als Klugscheißer beschimpft. Mit oder ohne Berechtigung?
Man könnte vielleicht sagen, er ist sehr selbstbewusst.
Mit 14 büxt Johann zum ersten Mal aus, später kommt er weit herum auf der Welt – bis nach Australien. Wie haben Sie die Orte ausgewählt, an die es ihn verschlägt?
Das hat mit Johanns realem Vorbild Heinrich Kieber zu tun. Einige Orte, an die sich Johann begibt, sind für Kiebers Biographie wichtig gewesen, andere hingegen haben vielleicht etwas mehr mit mir selber zu tun oder unterliegen dem Berufsgeheimnis.
Eine Lichtgestalt im Leben von Johann ist Gina, wie Fürstin Georgine von und zu Liechtenstein liebevoll genannt wurde. Wie kamen Sie darauf, die Landesmutter zur Romanfigur zu machen?
Auch hier lässt Heinrich Kieber schön grüßen. Ähnlich wie Johann ist er in einem Kinderheim aufgewachsen, das unter der Schirmherrschaft Fürstin Ginas stand, mit der er sich nachweislich sehr gut verstanden hat. Ich fand es interessant, dass die Landesmutter beinahe zu einer wirklichen Mutter wird, und Johann, ihr „Sohn“, dann derjenige ist, der nach ihrem Tod das Chaos über die Monarchie und den Kleinstaat hereinbrechen lässt. Die Eigentümerin der Bank, die Johann bestiehlt, ist ja niemand geringeres als die fürstliche Familie.
So gut wie Gina kommen nicht alle aus Liechtensteins besseren Kreisen in Ihrem Roman weg. Was hat Sie bei der Darstellung, z.B. beim Duell zwischen Johann Kaiser und dem Fürsten, geleitet?
Wirklichkeit, Fantasie und Spekulation.
„Vom Hofnarr zum Whistleblower.“
Vom Fürstentum kommt man auf Hofnarr oder zeitgemäßer: Whistleblower. Wie würden Sie Johann König da einordnen?
Ich nehme beides und sage: Johann Kaiser war Hofnarr, bevor er zum Whistleblower geworden ist; und wäre er nie Hofnarr gewesen, hätte er nie Whistleblower werden müssen.
Ist Johann aus Ihrer Sicht eher ein Held oder Antiheld?
Er ist ein Held, weil er durch seinen Diebstahl eine Steueroase trockengelegt hat. Er ist ein Antiheld, weil das Trockenlegen der Steueroase nur Mittel, der Zweck aber ein ganz anderer war.
Johann gibt – wie Oskar – Auskunft über sein Leben. Was macht ihm das so wichtig?
Johann droht, die Deutungshoheit über sein Leben zu verlieren. Während er in einigen Staaten als Whistleblower gefeiert wird, gilt er in Liechtenstein als größter Verräter aller Zeiten. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Um gegen diejenigen anzukämpfen, die diese Lügengeschichten verbreiten, muss er seine Geschichte selber erzählen. Und zwar so, wie es wirklich gewesen ist.
Bekenntnisse eines Hochstaplers? Oder die Beichte eines Opfers der Umstände?
Je nachdem, wen man fragt. Johann würde wahrscheinlich letzteres sagen, ich hingegen bin mir da nicht so sicher.
Inwieweit dürfen Leser Johanns Schilderungen für bare Münze nehmen?
Das entscheidet am besten jede und jeder für sich.
„… eine Spiegelung, sowohl formal als auch inhaltlich.“
Johann schlüpft in unterschiedliche Rollen und holt z.B. als angeblicher Journalist Auskünfte ein. Worum ging es Ihnen dabei als Autor?
Eine Gemeinsamkeit zwischen Johann und mir ist, dass wir beide schreiben. Wir interessieren uns beide für Texte, die mit Fakten angereichert sind und haben eine gewisse Liebe zum Detail. Um dem gerecht werden zu können, muss man gezwungenermaßen recherchieren. Mir hat die Idee gefallen, Johann seine eigene Geschichte recherchieren zu lassen so wie ich Johanns Geschichte recherchiert habe. Das ist ein Grund. Ein anderer ist, dass Johann in einem Zeugenschutzprogramm lebt, und sich nicht zu erkennen geben darf. Um nicht gefunden zu werden, muss er sich verwandeln. Und die Kunst des Verwandelns hat er sein Leben lang geübt. Das versucht der Text zu spiegeln, sowohl formal als auch inhaltlich.
Sie arbeiten nicht nur mit Buchstaben, sondern auch mit schwarzen Balken und teilweise mit roter Schrift. Was veranlasste Sie zu diesen Besonderheiten? Was macht sie womöglich notwendig für die Authentizität des Erzählens?
Wie oben angetönt, ist das einzige, was Johann geblieben ist, seine Geschichte. Nur, wenn es ihm gelingt, die Leserinnen und Leser von seiner Sicht der Dinge zu überzeugen, hat das, was er getan hat, Sinn ergeben. Das macht das Erzählen an sich zu einer fast lebenserhaltenden Maßnahme. Darum zieht Johann alle Register. Fraglich ist nur, ob das tatsächlich hilft.
Nicht zuletzt könnte man Ihren Roman als Hommage an die Fußnote verstehen. Welche Funktionen erfüllt sie für Sie?
Für mich selbst und für Johann haben die Fußnoten unterschiedliche Funktionen. Für Johann sind sie Wahrheitsbeweis, mir selbst schenken sie einerseits die Möglichkeit, auf die Texte zu verweisen, die für die Arbeit an „Für immer die Alpen“ wichtig waren, andererseits zeigen die Fußnoten auf, dass diese Geschichte nicht nur meine Geschichte, sondern in nicht wenigen Teilen anrecherchiert ist und teilweise auf Realia basiert. Das transparent zu machen, war mir wahnsinnig wichtig.
Für einen Auszug aus Ihrem Debütroman wurden Sie beim „open mike“ ausgezeichnet, der als einer der wichtigsten Literatur-Wettbewerbe für Neuentdeckungen gilt. Welche Bedeutung hatte der Preis 2016 für Sie?
Zuerst einmal war es eine riesige Bestätigung, die ich als Zeichen dafür gewertet habe, dass ich mit dem Romanprojekt nicht auf einem vollkommen falschen Weg bin. Gleichzeitig kam ich durch den Preis in direkten Kontakt mit Verlagen und Agenturen, und so hat es sich ergeben, dass ich jetzt bei Luchterhand gelandet bin, wo es mir übrigens sehr gut gefällt.
Den Preis beim „open mike“ bekamen Sie 2016, als Sie mitten im Schreibprozess steckten. Wie war damals der Stand der Dinge? Waren Sie sich Ihrer Sache sicher?
Es gab etwas mehr als ein Kapitel – von insgesamt 15. Ich war eigentlich nirgends, und ob das was taugt, wusste ich auch nicht. Daher gab es nicht so viel Anlass, sich in irgendetwas zu sicher zu sein.
„5 Jahre, um mich selbst immer wieder zu überzeugen …“
Wie lange haben Sie an Ihrem Debütroman gearbeitet und was waren die größten Herausforderungen?
Ungefähr 5 Jahre. Etwas vom Schwierigsten war, mich immer wieder von neuem davon zu überzeugen, dass es nicht komplett unrealistisch ist, dass dieser Text jemals fertig wird. Und dass ihn dann auch noch jemand lesen möchte.
Sie haben in Hildesheim und Wien Literarisches Schreiben studiert. Was waren dabei die wertvollsten Erfahrungen und Lektionen für Sie? Inwiefern war es ein Gewinn bei der Arbeit an Ihrem Debütroman?
Es war schön, viele nette Menschen kennenzulernen, die alle eine Leidenschaft teilen. Sich über Bücher austauschen zu können, Ideen und Texte und all das zu besprechen, war ein großes Glück. Und an diese Menschen konnte ich mich dann unter anderem wenden, wenn es beim Schreiben gerade nicht so geklappt hat. Das hat unheimlich geholfen.
Ihr glücklichster Moment beim Schreiben?
Einen glücklichsten gab es nicht, dafür viele kleine glückliche: wenn eine Idee funktioniert hat beispielsweise, oder ich einen Satz endlich so hingekriegt habe, wie ich ihn haben wollte.