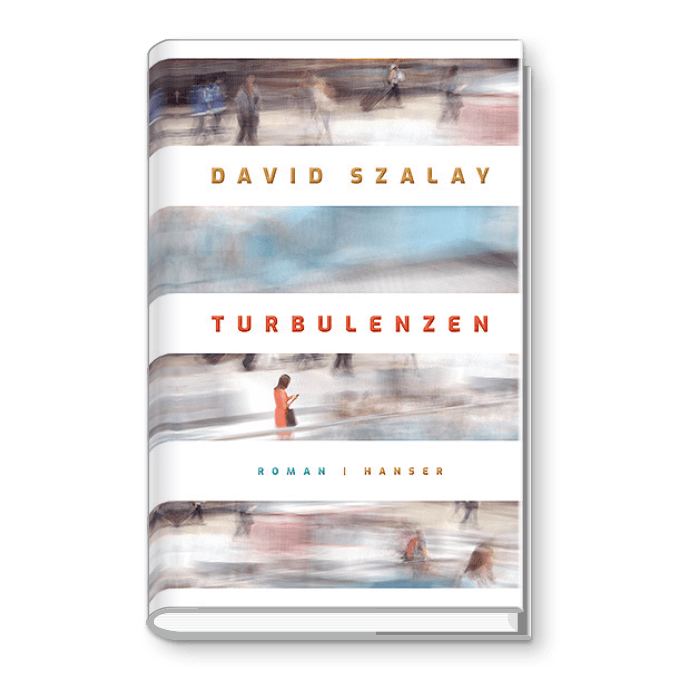Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 190 Lesepunkte sammeln
190 Lesepunkte sammeln
WER WEISS NOCH, wie der Himmel im letzten Sommer aussah, wenn man nach oben blickte? Kondensstreifen und silberne winzig kleine Flugzeuge durchkreuzten das Blau. Unvorstellbar, dass es je anders sein könnte. Flughäfen voller Menschen, die von A nach B wollen, ein weltumspannendes Netz der Bewegungen durch hohe Lüfte, über den Wolken. Über diese Menschen, die unterwegs sind, aufbrechen, heimkehren, ankommen, schreibt David Szalay in seinem neuen Roman „Turbulenzen“.
Mr. Szalay, leben wir in außergewöhnlichen Zeiten oder ist das einfach unsere persönliche Wahrnehmung?
Ich vermute, dass sich die Zeit, in der wir gerade leben, immer besonders anfühlt. Wir haben den Eindruck, jetzt passiert etwas Unerwartetes oder Beispielloses. Dennoch denke ich, 2020 wird das Jahr sein, das für die Zukunft zählen wird. Zum Beispiel die Corona-Krise: Das noch nie Dagewesene ist ihr globales Ausmaß. Jeder noch so kleine Teil der Welt ist davon betroffen, das ist nun wirklich kein „normales“ Ereignis. Natürlich wird 2020 auch politisch gesehen ein signifikantes Jahr sein. Falls Trump im November verliert, besonders wenn es nicht eben knapp ist, wird das Echo auf der ganzen Welt zu spüren sein, vielleicht hat der Populismus dann damit seinen Peak erreicht. Was ich damit sagen will: Ja, meiner Meinung nach erleben wir jetzt in diesem Moment eine historisch wichtige Zeit.
Wie hat sich die Corona-Krise auf Ihren Alltag ausgewirkt?
Sehr spürbar, denn ich habe Kinder im Schulalter. Diese plötzlich jeden Tag die ganze Zeit um sich herum zu haben, war eine große Veränderung. Wir mussten alle einen neuen Weg des Zusammenlebens finden. Ich habe tatsächlich das Gefühl, sie nun besser zu kennen als noch vor ein paar Monaten. Was man dabei auch plötzlich versteht, ist die zentrale Rolle der Schulen, die unsere Gesellschaft überhaupt funktionieren lässt. All die anderen Unannehmlichkeiten, Einkaufen, das Tragen der Masken, das Einfrieren des sozialen Lebens, war keine so große Sache im Vergleich dazu. Ich hatte auch das Glück, dass ich gerade in der Mitte eines neuen Romans stecke. Das ist wahrscheinlich die Zeit im Arbeitszyklus eines Schriftstellers, in der sein Leben am meisten abgeschottet und introvertiert ist. So kam es, das ich beruflich überhaupt nicht eingeschränkt war.
„Zum Glück war ich gerade in der Mitte eines neuen Romans.“
Was gibt Ihnen das Gefühl, ein Schriftsteller zu sein? Können Sie sich erinnern, wann dieses Gefühl zum ersten Mal eintrat?
Eine Antwort könnte sein zu sagen, das war, als ich das erste Mal zum Vergnügen schrieb, einfach nur, weil ich es wollte. Ich muss so neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. Eine andere wäre vielleicht, als ich das erste Mal für mein Schreiben bezahlt wurde. Das ist dann etwa zwanzig Jahre später passiert. Aber selbst da fühlte es sich provisorisch an. In den letzten paar Jahren hatte ich das Glück, vom Schreiben allein leben zu können. Erst seitdem kann ich mich mit vollem Selbstbewusstsein als Schriftsteller bezeichnen.
Spüren Sie ein Bedürfnis, einen Drang zu schreiben?
Das ist interessant. Wenn ich zwischen zwei Büchern bin, fühlt es sich an, als könnte ich den Rest meines Lebens verbringen, ohne je wieder irgend etwas schreiben zu wollen. Aber wenn ich tatsächlich im Schreibprozess stecke, dann passiert es immer wieder, dass sich dieser fanatische Fokus, diese Obsession einstellt – ja, eben ein Drang. Wenn es gut läuft, dann kann das extreme Befriedigung und Freude in einem auslösen. Und wenn es schlecht läuft, dann passiert natürlich genau das Gegenteil. Der persönliche Einsatz dabei ist manchmal sehr hoch. Darüber hinaus kann das Schreiben eine Art zu denken werden, oder zu einem Prozess, die Realität zu verarbeiten – es ist einfach eine Angewohnheit, aber es kann Teil dessen sein, was für uns den Sinn des Lebens ausmacht. An diesem Punkt bin ich wohl gerade und das ist es, was mich zum Weiterschreiben bringt, ganz ohne Druck von außen.
„Der persönliche Einsatz ist dabei manchmal sehr hoch.“
Und wie sieht es mit den vielbeschworenen Schreibroutinen aus? Ist es für Ihren kreativen Flow wichtig, wann, wo und wie Sie schreiben?
Das wird gerne übertrieben – nicht zuletzt von den Schriftstellern selbst, mich selbst eingeschlossen. Ich ertappe mich oft dabei, kleine Angewohnheiten zu verehren, oder zu glauben, nur an diesem oder jenem Platz schreiben zu können. Aber tatsächlich ist das gar nicht so wichtig. Das, was ich wirklich brauche, sind nur ein paar Stunden Ungestörtheit, ohne Unterbrechung. Ich könnte nicht an Orten wie Cafés oder Bibliotheken schreiben. Ich brauche Einsamkeit. Naja, eigentlich stimmt das gar nicht zu 100 Prozent – zum Beispiel ist vieles an den Korrekturarbeiten für „Turbulenzen“ im Zug entstanden. Wenn ich ins Stocken gerate, dann arbeite ich mit der „1000 Wörter pro Tag“-Regel, ich bin sicher, Sie haben davon gehört, das hilft!
Für wen schreiben Sie, für sich selbst oder für Ihre Leser?
Beides. Ganz bestimmt habe ich immer einen Leser im Hinterkopf, denn ich sehe das Schreiben auch als eine Art Spiel, das der Schriftsteller mit seinem Leser spielt. Ich muss natürlich über Dinge schreiben, die mich selbst interessieren. Ich schreibe auf diese Art wohl Bücher, die ich selbst gerne lesen würde.
„Schreiben ist auch eine Art Spiel mit dem Leser.“
Mit „Turbulenzen“ haben Sie eigentlich Kurzgeschichten vorgelegt, die aber so sehr ineinandergreifen, dass sie dennoch als Roman durchgehen können. War das von Anfang an Ihre Absicht?
Ganz klar war es meine Absicht, ein einzelnes unabhängiges Werk zu schreiben und nicht eine Sammlung kurzer Texte, die dann zufällig in einem Band veröffentlicht werden. Die „Turbulenzen“ entstanden ursprünglich für einen Rundfunk-Auftrag der BBC, die wollten eine Reihe zusammenhängender Kurzgeschichten, von denen aber auch jede für sich alleine stehen kann. Eigentlich habe ich ja für meinen Vorgängerroman „Was ein Mann ist“ etwas Ähnliches gemacht. Die Grundidee, dass eine Reihe von Kurzgeschichten mehr aussagen kann als die Summe ihrer Teile, sogar spezielle Themen wesentlich stärker ausdrücken kann als eine durchgängige Geschichte, diese Grundidee ist dieselbe.
„Turbulenzen“ lautet der Titel Ihres Buches. Und die Turbulenzen des Lebens, die Schlüsselmomente, sind die Essenz jedes Kapitels. Ging Ihnen das leicht von der Hand?
Für mich war es ungewöhnlich, so knappe Geschichten zu schreiben, aber das waren nun einmal die Anforderungen der BBC. Noch ungewöhnlicher war die Forderung, dass alle Geschichten exakt dieselbe Länge haben sollten. Das erschien mir erst einmal entmutigend. Sobald ich einmal die Idee für den Plot einer Geschichte hatte, und oft hatte ich den schon, bevor ich überhaupt anfing zu schreiben, wurde es eigentlich ganz leicht und ich hatte richtig Spaß daran. Die meisten der Geschichten waren im ersten Wurf zu lang. Ich kürzte und hatte das Gefühl. Hier darf es nicht ein einziges überflüssiges Wort geben. In etwa vergleichbar mit dem Schreiben von Lyrik. Jeder Satz muss sitzen, muss etwas bewirken. Das genoss ich sehr.
2016 kamen Sie mit „Was ein Mann ist“ auf die Shortlist für den Man Booker Prize. Was löste das bei Ihnen aus?
Es gibt so viele Bücher auf der Jagd nach Lesern, dass alles, was einem einzelnen Buch Aufmerksamkeit schenkt, sehr hilfreich ist. Auf der Shortlist für einen der großen internationalen Preise wie den Booker zu stehen, hilft in jedem Fall. Die Verkaufszahlen stiegen deutlich zu dieser Zeit. So etwas kann der Durchbruch sein.
„Schlechte Kritiken sind zermürbend.“
Wie gehen Sie mit den Rezensionen, mit Kritik um? Lesen Sie die, nehmen Sie davon etwas auf?
Ich vermeide es, die Besprechungen meiner Bücher zu lesen, sogar dann, wenn der Verlag sie mir zuschickt, und die schicken ja normalerweise nur die guten! Schlechte Kritiken sind zermürbend. Eine hat mich mal so gestresst, das ich kurzzeitig wieder zu rauchen anfing … Konstruktive Kritik ist aber immer sehr hilfreich, ja unverzichtbar. Ich lasse so viele Menschen wie möglich vorab lesen, damit ich ihr Feedback bekomme. Beim Schreiben kann man so sehr eintauchen, dass man selbst nicht mehr klar sehen kann.
Was lesen Sie gerade, Mr. Szalay?
Ich lese „Middlemarch“ von George Eliot, ich habe es (natürlich) während dem Lockdown begonnen, als ich das Gefühl hatte: Jetzt ist die richtige Zeit für einen Klassiker, den ich noch nicht kenne. Ich bin immer noch dabei … es ist brillant, aber sehr lang.
Welche Schriftsteller bewundern Sie und wofür?
Von den zeitgenössischen Britischen fallen mir Alan Hollinghurst, Rachel Cusk, Jon McGregor ein. Ein Buch, das ich kürzlich gelesen habe und das mich sehr beeindruckt hat, war „Ultraluminous“ von Katherine Faw – ein Werk von anhaltender Intensität und ehrfurchteinflößender Disziplin. Unwiderstehlich. Obwohl ich etwas enttäuscht von seinem Ende war.
London ist in einigen Ihrer Romane so lebhaft und lebendig beschrieben. Warum haben sie diese Stadt verlassen und was bedeutet Sie Ihnen heute?
Sie bedeutet mir sehr viel, ich bin dort aufgewachsen, habe dort gelebt, bis ich 30 war, und irgendwie fühlt es sich dort so zuhause an wie nirgends sonst auf der Welt. Das Buch, an dem ich gerade schreibe, spielt hauptsächlich dort. Ich habe diese Stadt eigentlich nicht absichtlich verlassen … es war ungefähr vor einem Jahrzehnt, und ich dachte, ich kämme ziemlich schnell zurück. Es gibt viele Gründe dafür, warum es nicht so kam. Einer, ein ganz banaler, aber umso wichtiger, ist das Geld. Vielleicht macht der Brexit es schließlich wieder erschwinglich. In der Regel komme ich fünf oder sechs Mal im Jahr dorthin, wegen Corona war ich seit Januar nicht mehr dort, was damit meine bisher längste Zeit ohne London ist.
… und was lässt Sie sich „zu Hause“ fühlen, wo auch immer Sie leben?
Oh das ist eine interessante und schwierige Frage. Auf einer Ebene Routine, Vertrautheit, meine eigenen Dinge um mich herum und ein funktionierendes Netzwerk. Aber dann ist da die viel tiefer gehende Frage nach der Verbundenheit zu einem Ort, dem Verwurzeltsein. Es gibt verschiedene Wege, sich irgendwo zu Hause zu fühlen. Irgendwie wird London für mich immer zu Hause sein, vielleicht auch viel mehr als Budapest, zum Beispiel, das je sein kann. Aber auf eine andere, viel weniger komplizierte Art fühle ich mich natürlich hier zu Hause, in Budapest.
„Ich lebe sehr gerne in Budapest.“
Was denken Sie über Ungarn, und können Sie uns etwas über den ungarischen Buchmarkt erzählen? Sind sie auch dort übersetzt?
Ungarn, hm, ich lebe sehr gerne in Budapest. Außerhalb Ungarns liegt der Fokus der Medien verständlicherweise auf der prekären politischen Situation, aber tatsächlich hat das keine Auswirkungen auf das alltägliche Leben hier. Die ungarische Hauptstadt ist einfach eine lebendige europäische Stadt mit sehr viel Charme und Geschichte. Tatsächlich hat die Regierung hier regelmäßig Stimmverluste hinzunehmen. Der Buchmarkt ist klein, und ich bin nicht wirklich tief drin, denn mein Ungarisch ist nicht gut genug, um Literatur im Original zu lesen. Aber meine Bücher gibt es tatsächlich auf Ungarisch, und ab und an nehme ich an Events teil, was mich immer sehr freut.
Zu guter Letzt noch eine Frage: Wie könnte ein paralleles Leben von David Szalay aussehen?
Auf eine Art sind meine Bücher Übungen in Parallelleben für mich selbst. Das ist gar nicht so einfach, sich auf eines zu beschränken. Ich weiß wirklich nicht, was ich gemacht hätte, wäre ich kein Schriftsteller geworden. Einer der Gründe warum ich beim Schreiben blieb, obwohl das Glück nicht auf meiner Seite zu sein schien (und das ist erstmal bei jedem so, der versucht, ein Schriftsteller zu sein) war, das ich einfach keine guten Alternativen hatte. Hätte ich eine attraktive Karriereidee gehabt, ich hätte diese gewählt. Was hätte das wohl sein können? Mehrfach wollte ich Fotograf werden, dann wieder Gartendesigner. Aber mal realistisch betrachtet: Hätte es mit dem Schreiben nicht geklappt, ich weiß nicht, wohin das hätte führen sollen. Es ist fast beängstigend im Rückblick, wie sehr ich mich auf diesen einen Weg eingeschossen hatte. Das hat sich aber nicht mutig oder so angefühlt damals, denn ich habe wohl das Risiko, das ich für meine Zukunft, für mein Leben einging, gar nicht voll erfasst. Das bedeutet es wohl jung zu sein, den Schneid zu haben, etwas zu tun, nur weil du das Risiko nicht voll wahrnehmen kannst. Ich habe Ihre Frage gar nicht wirklich beantwortet. Wahrscheinlich wäre ich Barbesitzer irgendwo auf dem Balkan und würde mich täglich in ein anderes Leben träumen.