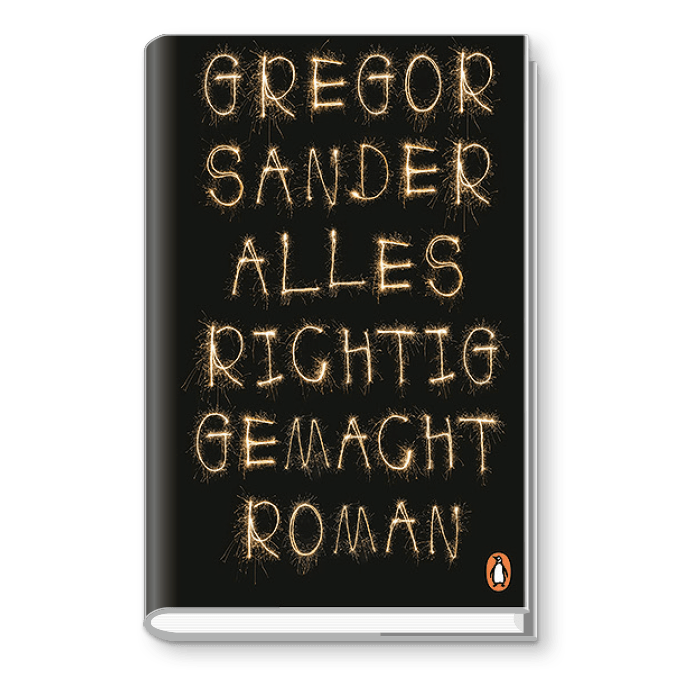Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 200 Lesepunkte sammeln
200 Lesepunkte sammeln
GREGOR SANDER beeindruckt nicht nur als Maler mit Worten, sondern feiert Sinnlichkeit: „Ich möchte, dass man meine Bücher auch riechen und schmecken kann.“ Wenn der 1968 in Schwerin geborene Autor dem Lebensgefühl seiner Generation nachspürt, dann wird verkostet: vom Sanddornwodka der jugendlichen Stürmer und Dränger in den letzten Monaten der DDR bis zum gepflegten Chardonnay der erwachsenen Männer im Berliner Villengarten. Als Chronist im wiedervereinigten Deutschland brilliert er mit seinem neuen Roman „Alles richtig gemacht“.
In diesem Herbst kommt die Verfilmung Ihres preisgekrönten Romans „Was gewesen wäre“ in die Kinos. Der Romantitel könnte auch gut als Ihr literarisches Gesamtmotto passen, oder?
Absolut. Das Leben bietet ständig Abzweigmöglichkeiten. Darüber könnte man eigentlich verrückt werden. Oder eben Bücher schreiben.
An „Was gewesen wäre“ haben Sie 2013 gearbeitet – und unter anderem diese eigene literarische Tätigkeit festgehalten in Ihrem „Tagebuch eines Jahres“, das man als Hommage an Uwe Johnsons „Jahrestage“ verstehen könnte. Wie sehen Sie es selbst?
Ich wollte die Themen des Jahres 2013 im Spiegel der Tagespresse festhalten. Dafür habe ich jeden Tag eine andere Zeitung gekauft und meinen persönlichen Artikel des Tages herausgesucht. Und ich liebe Uwe Johnsons „Jahrestage“.
Wie der auf die „New York Times“ abonnierte Uwe Johnson sind Sie offenbar leidenschaftlicher Zeitungsleser. Lesen Sie schnell quer oder ganz genau? Auf Papier? Oder digital? Und welche Rubriken vorzugsweise?
Erst Politik, dann Feuilleton, Sport nur noch selten. Wirtschaft kaum, was ich gern ändern würde. Meistens lese ich mich dann irgendwo fest. Aber ich blättere zumindest über alles drüber. Und ich lese gern unterschiedliche Zeitungen, um auch verschiedene Meinungen zu verstehen. Von der BILD bis zum SPIEGEL. Von der FAZ bis zur taz. Lokalzeitungen, wenn ich unterwegs bin. Am liebsten auf Papier, aber natürlich auch online.
„Ich habe linker Verteidiger gespielt.“
2013 haben Sie nicht zuletzt Ihr Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft der Autoren gegeben. Ihre sportlichen Vorbilder? Ihr Ehrgeiz? Ihre Erfolgsbilanz?
Schwieriges Thema. Vor drei Jahren habe ich mir das Knie im Training verdreht. Feierabend! Karriereende! Aber das war eine schöne Zeit mit Spielen gegen Schriftsteller in Israel oder Brasilien. Ich habe linker Verteidiger gespielt. Der Greifswalder Toni Kroos ist ein herausragender Spieler, was seine technischen Fähigkeiten angeht. Und er kann ein Spiel wirklich lesen und dirigieren. Davon war ich leider sehr weit entfernt.
Als Sie 2012 den „Preis der LiteraTour Nord“ verliehen bekamen, hat Sie der Laudator Elmar Krekeler mit Raymond Carver verglichen. Auch von Hemingway und eben Uwe Johnson war damals die Rede. Welche Bedeutung haben die beiden inzwischen für Sie?
Ich schätze Carvers und Hemingways Fähigkeit, mit wenigen Worten ein ganzes Leben zu beschreiben. Ihre Short Stories sind herausragend. Bei Johnson beeindruckt mich die Zeichnung der Figuren, sein historischer Weitblick und die sprachliche Eleganz. Wenn davon etwas auf mich abgefärbt hat, wäre ich sehr dankbar.
Der Klappentext bezeichnet Ihren neuen Roman „Alles richtig gemacht“ als „helle Feier der Freundschaft“. Was macht für Sie Freundschaft aus?
Verlässlichkeit. Vertrauen. Über alles reden, aber auch gemeinsam schweigen können. Man muss einen Freund nicht immer verstehen, aber man kann ihm vieles verzeihen.
„Etwas wagen, Ballast abwerfen.“
Die besagten Freunde im Roman sind Thomas und Daniel, die in der DDR aufwuchsen. Das Ende der DDR ist für die zwei Rostocker auch eine persönliche Wende. Inwiefern lassen sie die Vergangenheit hinter sich? Geht das überhaupt?
Ja und nein. Es ist wichtig im Leben, auch neu anzufangen. Etwas zu wagen, Ballast abzuwerfen. „Der ist immer noch genauso wie früher“, das empfinde ich fast als Beleidigung. Wozu war man dann auf der Welt? Aber natürlich wirkt die Vergangenheit auch nach. Wer die DDR erlebt hat, der hat andere Erfahrungen gemacht als ein Gastarbeiterkind. Und beide haben so Stoff für Geschichten.
Was verbindet und was trennt die ungleichen Freunde Thomas und Daniel?
Daniel geht immer aufs Ganze. Er überlegt nicht viel, ist intuitiv und cool. Thomas ist nachdenklicher, bürgerlicher und auch etwas feige. Allerdings nutzt sich Daniels Charme über die Jahre ab, und es gibt Menschen, die Thomas’ Verlässlichkeit schätzen.
Rund ein Vierteljahrhundert später bekommt Thomas vorgeworfen, er sei „immer noch so eine Ostbirne“. Was ist da dran?
Ich fand es lustig, wenn eine gebürtige Polin einem Rostocker vorwirft, eine „Ostbirne“ zu sein, nur weil sie in Westberlin aufgewachsen ist. Diesen ganzen Himmelsrichtungsquatsch sollten wir mal langsam loswerden.
Attestiert wird Thomas auch ein ziemlich beschränkter Horizont, was Berlin anbelangt. Was macht denn Ihr Berlin-Lebensgefühl aus? Wo schlägt für Sie das Herz der Stadt?
Berlin hat viele Herzen. Ich glaube, das ist es, was ich an der Stadt so mag. Und jeder kann eben seines finden. Ich lebe seit zwanzig Jahren in Mitte und schreibe seit elf Jahren im Wedding.
Den Befürchtungen seines Vaters zum Trotz hat es Thomas doch zu etwas gebracht: Er ist Anwalt mit poliertem Messingschild an der Tür. Nach welchen Kriterien haben Sie ihm seine bürgerliche Existenz verpasst?
Das eigene Haus war wichtig. Die Bedeutung von Wohnraum hat sich komplett geändert in den letzten zwanzig Jahren. Thomas lebt mit seiner Familie in einer alten Botschaft, die in der DDR im Bauhaus-Stil gebaut wurde. Ein Betonquader mit Flachdach und großem Garten mitten in der Stadt. Nach der Wiedervereinigung wollte die keiner haben – und heute sind sie ein Vermögen wert.
Im Gegensatz zu Thomas schon auf den ersten Blick ziemlich unkonventionell ist seine Kanzleipartnerin Agneszka, die mit Pippi Langstrumpf nicht nur die Haarfarbe, sondern auch die Subversivität gemeinsam hat. Warum ist sie genau richtig als Kollegin von Thomas?
Weil sie wesentlich energiegeladener ist als Thomas und ihn immer wieder aus seinem Trott bringt.
Agneszka kommt aus Polen. Wie ist sie durch ihre Kindheit und Jugend geprägt?
In Polen herrschte Anfang der 80er Jahre das Kriegsrecht. Man kann die Solidarność und den polnischen Katholizismus auch als Anfang vom Ende des Sozialismus sehen. Agneszka war noch ein Kind und verließ aus politischen Gründen mit ihrer Familie Polen, um in Westberlin neu zu beginnen. Das hat sie zupackend gemacht, nachdenklich und pragmatisch.
„Zuhause kann ich überall sein … “
Unterscheiden Sie zwischen Heimat und Zuhause?
Heimat ist für mich der Ort, der einen als Kind geprägt hat. Wo man vielleicht geboren, aber auf jeden Fall aufgewachsen ist. Ein Zuhause kann man sich suchen. Zuhause kann ich überall auf der Welt sein. Aber Heimat, das ist so etwas wie die eigenen Eltern. Das kann man sich nicht aussuchen.
Herkunft heißt nicht zuletzt: regionale Sprachgepflogenheiten, Dialekteinfärbungen, Sprichwörter und Slang. Wieviel der sprachlichen Besonderheiten aus Ihrer Schweriner Kindheit haben Sie noch intus? Haben Sie noch einen spontanen aktiven Wortschatz für den Alltagsgebrauch? Und was löst das Hören und Sprechen bei Ihnen aus?
Bei uns tütert man sich auf Festen einen an und sagt dabei: Prost, wer nich hät, der host. Also wer nichts hat, der hustet. Eigentlich klingt vieles freundlicher als im Hochdeutschen. He süpt n betten hört sich netter an, als wenn es heißt: Der säuft.
Übersetzen Sie uns doch bitte mal die Äußerung von Thomas‘ Vater, als es um die Zukunft des Jungen ging, der eben nicht die elterliche Drogerie übernehmen wollte: „Dat wär ja zu döschig … Da wärst du ja mit ‚m Klammerbüttel gepudert, nich.“ Was sagt uns das?
Ich spreche kaum noch Platt, aber das sind Sätze, die in meiner Kindheit fielen. Döschig heißt doof und wenn jemand mit dem Klammerbüttel gepudert ist, dann hat er nicht alle Tassen im Schrank.
„Ich muss in alle meine Figuren hinein.“
„Gregor Sander kann Szenen schreiben, die so plastisch sind, dass man in ihnen spazieren gehen kann, begeisterte sich Dirk Knipphals in „Deutschlandradio Kultur“. Seine Feststellung trifft auch auf Ihren neuen Roman zu. Zu Beginn fühlt man mit Ihrem Helden Thomas das taufeuchte Gras und wärmt sich die Hände an der Kaffeetasse. Hockt der Autor Gregor Sander bei Sonnenaufgang im Garten, um das so zu empfinden und zu formulieren? Welcher Anspruch steckt dahinter?
Ich muss in alle meine Figuren hinein. Muss wissen, wie sie denken und empfinden. Damit verbringe ich die meiste Zeit. So ähnlich, wie sich ein Schauspieler eine Rolle erarbeitet. Ich fahre beispielsweise an Orte, die für die Figur wichtig sind. Für diesen Roman also New York, Irland, die Bretagne, aber auch Rerik, Heiligendamm, Rostock. Meine Kinder lachen mich aus, wenn ich das Arbeit nenne. Aber wenn ich weiß, wie jemand tickt, dann habe ich auch eine Sprache für sie oder ihn.
Dr. Thomas Piepenburg realisiert gerade, dass ihn der Blues erwischt hat. Die Hauptursachen der Bredouille, in die Sie ihn gebracht haben? Ihre Kompaktdiagnose bitte!
Für Thomas ist alles ein bisschen viel geworden in letzter Zeit. Zu viel gearbeitet, zu viel getrunken, zu wenig auf seine Freunde und Familie geachtet. Die Midlife-Crisis direkt vor der Nase. Dann kommt die Vergangenheit in Gestalt seines alten Freundes Daniel zurück, Frau und Kinder sind plötzlich verschwunden und schon ist Feuer unterm Dach.
Schon in „Was gewesen wäre“ und nun in Ihrem neuen Roman „Alles richtig gemacht“ gehört zu den zentralen Motiven das Verlassen und Verlassenwerden, Verrat, das Verschwinden und unverhoffte Wiederauftauchen. Was beschäftigt Sie so intensiv daran?
Wenn ich das so genau wüsste, würde ich vermutlich keine Romane mehr schreiben.
„Kunst – auch Literatur – ist Freiheit!“
In Ihrem Roman kommt immer wieder Kunst vor, z.B. am Anfang als Aktion, die durch Fantasie-Beflaggung an Häusern im Stadtviertel die Erinnerung fördern will, oder in den Rückblenden bei den Erinnerungen an Thomas‘ Freundin Kerstin und die anderen Kreativen an der Fachschule für Angewandte Kunst, kurz: FAK. Welche Rolle schreiben Sie der Kunst zu? In Ihrem Roman? Und im wirklichen Leben? Und was trauen Sie ihr zu?
Ich beneide die Bildenden Künstler. Um die Arbeit mit den Händen, die Materialien, die Farben. Dass man am Ende etwas sieht. Kunst – auch Literatur – ist Freiheit. Für den, der sie erschafft, aber auch für den, der sie betrachtet.
Sie streuen immer wieder Literaturanspielungen ein: von Kästners „fliegendem Klassenzimmer“ bis zu Canettis „Blendung“ oder das Ostseebad Rerik, das wir aus Alfred Anderschs „Sansibar oder der letzte Grund“ kennen. Welchem Prinzip folgen Sie da? Oder sind es persönliche Anker und Vorlieben?
Ich wollte dieses Mal Leser im Roman. Leser und Nichtleser. Das sagt etwas aus, ob jemand liest oder nicht. Und es verbindet Menschen gemeinsam zu lesen. Die meisten genannten Bücher kamen intuitiv beim Schreiben.
Inwiefern ist das Schreiben für Sie autobiografische Selbstbefragung?
Ich benutze alles für das Schreiben. Eigene Erfahrungen, Gehörtes, Gelesenes, Filme, Musik, Reisen, Erfragtes und natürlich viel Fantasie. Im Vordergrund steht immer der Text. Ob ich das so erlebt habe oder nicht, ist mir völlig egal. Der Text muss stimmen.