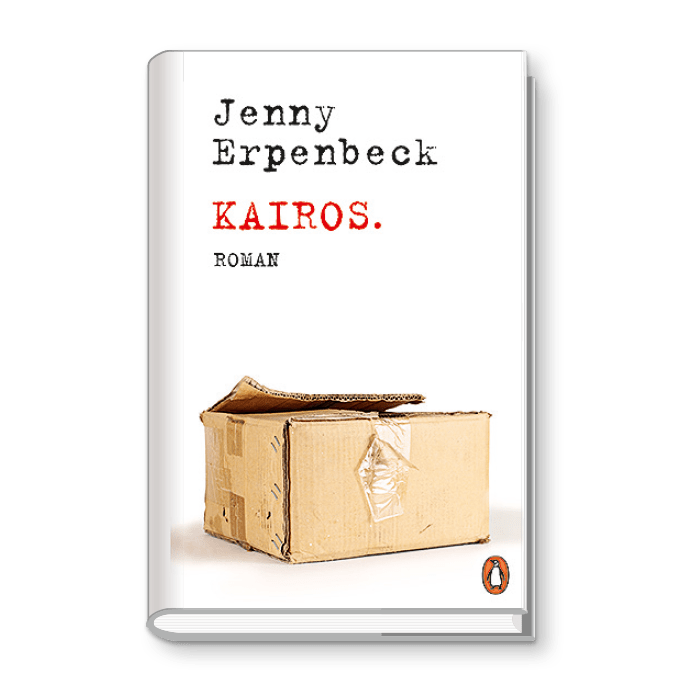Auch als eBook und Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 220 Lesepunkte sammeln
220 Lesepunkte sammeln
JENNY ERPENBECK zählt zu den außergewöhnlichsten literarischen Stimmen hierzulande. Kopf und Herz sind wohl nur selten so vollkommen im Einklang wie im epischen Werk der Berliner Schriftstellerin, die auch als Musiktheater-Regisseurin aktiv war. Perfekt durchkomponiert bis ins Detail und zugleich geprägt von Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit sind ihre Romane, zuletzt der Sensationserfolg „Gehen, ging, gegangen“ und nun „Kairos“, in dem sie einer großen Liebe nachspürt.
In der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung haben Sie erklärt, wenn Sie sich „für die Flucht vor dem Weltuntergang ein Buch aussuchen könnten oder müssten“, würden Sie Ovids „Metamorphosen“ wählen. Seit wann begleitet Sie dieses Werk und was macht es Ihnen so wertvoll?
In der Schule sollte ich im Lateinunterricht die Passage über die Zeitalter aus den „Metamorphosen“ übersetzen – das war meine erste Begegnung mit diesem Buch. Seitdem habe ich es in verschiedenen Lebensphasen immer wieder neu gelesen. Es gibt nichts Interessanteres als die Frage, wie ein Übergang, eine Verwandlung stattfindet, warum und unter welchen Umständen. Eigentlich ist das die Frage nach dem Leben selbst.
In Ihrem Ovid-Essay schreiben Sie über sein Konzept: „Nur wenn von der Verwandlung erzählt wird, bewahrt das Verlorene seine Identität.“ Wie wichtig ist Ihnen selbst dieser Antrieb als Schriftstellerin?
Ohne eine Idee von Kontinuität ist das Leben schwer auszuhalten. Aber es ist eben nicht die vererbte Rolex-Uhr, die das Reich der Lebenden und der Toten zusammenhält, sondern die Erinnerung, die Erzählung.
„Die Gelegenheit beim Schopf packen.“
Der Romantitel hat seinen Ursprung in der altgriechischen Mythologie. Was hat es mit Kairos auf sich?
Kairos ist der glückliche Augenblick, der sich in einem Meer von Zeit plötzlich auftut. Der Gott Kairos wird als Wesen mit einer Locke vorn an der Stirn dargestellt, an der man ihn packen und halten kann. Ist er aber einmal vorübergeglitten, präsentiert er einem die kahle Hinterseite seines Schädels – und entwischt. Die Gelegenheit beim Schopf packen, das erfordert Eingebung, Intuition, auch Mut.
Untrennbar mit Kairos verbunden ist Chronos. Was interessiert Sie am Verhältnis der beiden und am Phänomen Zeit?
Es ist vielleicht am besten zu erklären an der Struktur mehrstimmiger Musik – da gibt es die horizontale Ebene der Melodie, und gleichzeitig die Durchsichtigkeit der vertikalen Schichtung, der Harmonien. Diese Gleichzeitigkeit der zwei unterschiedlichen Erzählweisen hat mich immer fasziniert. Chronos, die Zeit, schreitet voran – das können wir an unseren Uhren ablesen. Zugleich hat jeder Augenblick eine Tiefendimension. Hat Bezüge zur Vergangenheit und zur Zukunft, ist Teil der Lebensgeschichte anderer Menschen. Manche dieser Bezüge erfahren, verstehen wir irgendwann, manche nie.
„Vergangenheit und Zukunft verlieben sich ineinander.“
Kairos kommt auch ihrer Protagonistin Katharina in den Sinn, als sie an ihre erste Begegnung mit Hans denkt. Eine Amour fou? Was ist für Sie das literarisch Reizvolle an diesem Paar?
Katharina und Hans gehören zwei verschiedenen Generationen an. Hans, der über dreißig Jahre Ältere, hat unter Hitler laufen gelernt. Katharina stand mit dem Pioniertuch um den Hals auf dem sozialistischen Appellplatz. Die Vergangenheit und die Zukunft verlieben sich ineinander. Drei Jahre später landen sie dann in der Gegenwart.
Wie Katharina sind auch Sie selbst in der Kulturszene großgeworden. Wie haben Sie im Kreis von Schriftsteller-Großeltern väterlicherseits, einem Philosophen als Vater und einer Übersetzerin als Mutter das Schreiben für sich entdeckt?
Als Kind habe ich Tagebuch geschrieben und leidenschaftlich gern gelesen. Es wurde viel über Literatur gesprochen, am Abendbrottisch, überhaupt im Alltag, und natürlich auch in den Sommerferien bei meinen Großeltern. Aber dass tagsüber alle an ihren Schreibtischen saßen und tippten, erschien mir ziemlich langweilig. Als Jugendliche dann wollte ich meinen eigenen Weg finden, und beruflich auf gar keinen Fall das gleiche machen wie meine Eltern und Großeltern. Erst mit Anfang zwanzig habe ich verstanden, dass ein Schreibtisch ein aufregender Ort sein kann und das Schreiben immer eigenes Schreiben ist, unabhängig von der Familie. Dass es schon lange auf mich wartet, und ich nur nachgeben muss.
Als Erstes haben Sie Theaterwissenschaft studiert, dann Musiktheaterregie. Wie beeinflusst und beflügelt Sie das beim Schreiben? Leiten Sie dabei eher Emotionen oder fachliches Wissen?
Ich habe bei meinen Studien und auch später in der Arbeit am Theater ein paar sehr nützliche Dinge gelernt: z.B. alles zu streichen, was nicht unbedingt zum Fortgang der Handlung beiträgt. Auch das Warten der Menschen und Dinge auf ihren Auftritt. Das Gewehr, das an der Wand hängt, muss irgendwann einmal losgehen, heißt es ja immer … Oder wie wichtig in einem Dialog das ist, was nichtausgesprochen wird. Und wie man gerade das hörbar machen kann: Das Schweigen. Überhaupt Klang, Rhythmus, Tempo – die Musik in der Sprache ist ja mindestens genauso wichtig wie der Inhalt.
„Musikhören, wenn man verliebt ist.“
Das Erste, was der Rundfunkredakteur Hans mit Katharina teilt, ist seine Lieblingsmusik: Klassik. Wie haben Sie die Auswahl getroffen und welche Bedeutung schreiben Sie der Musik in Ihrem Roman zu?
Ich habe Musikstücke genommen, die ich selbst als junge Frau mochte und oft gehört habe. Das Musikhören hat ja gerade, wenn man verliebt ist, viel mit dem Unbewussten zu tun, das einen mit einem anderen Menschen verbindet. Es öffnet eine andere Art von Raum, jenseits der Worte.
1986, zu Beginn des Romans und der Beziehung mit Hans, ist Katharina 19 – Ihre Generation. Was erscheint Ihnen generationstypisch? Welche Ähnlichkeiten gibt es in punkto Weltsicht zwischen Ihnen in ganz jungen Jahren und Ihrer Heldin?
Heute mutet es exotisch an, dass wir soviel Zeit diskutierenderweise in Kaffeehäusern oder bei Freunden verbracht haben. Dass wir überhaupt soviel Zeit hatten. Das lag natürlich daran, dass Geld im Osten überhaupt keine Rolle spielte. Was es nicht zu kaufen gab, bauten oder nähten wir uns selbst. Und Kunst hatte eine viel größere Bedeutung für uns, sie war ein Code zur Selbstverständigung. Unsere Reisen führten uns nicht auf die Malediven, sondern in die Gärten der Freunde: nach Brandenburg oder in die Schorfheide. Das Leben war langsamer und bescheidener, aber sehr intensiv. Nicht unähnlich dem letzten Jahr mit Corona.
Was hat Sie am zeitgeschichtlichen Hintergrund der untergehenden DDR und der Wendezeit beim Schreiben am meisten interessiert?
Die Spannung zwischen dem, was man hofft, und dem, was eintritt.
„Die existenzielle Erfahrung einer Grenzüberschreitung.“
Katharina bekommt 1986 eine Reisegenehmigung zum 70. Geburtstag ihrer Großmutter. Was war Ihnen an diesem Ausflug von Ost- nach Westdeutschland literarisch wichtig?
Es ist für Katharina die existentielle Erfahrung einer Grenzüberschreitung. Eine Reise ins Jenseits sozusagen. Der erste Blick von draußen aufs Eigene. Dieses Thema zieht sich von da an durchs ganze Buch. Die Frage: Wer ist man, wenn man das Niemandsland hinter sich gelassen hat, wenn man „zu weit“ gegangen ist? Wie kommt man wieder zurück ins Eigene, und kann man überhaupt je wieder zurück, wenn der eigene Blick sich indessen verwandelt hat?
Ein großes Thema bei Katharinas Reise in den Westen ist Freiheit. Was ist das Großartige und was das Ernüchternde daran?
Großartig scheint ihr, dass man beinahe alles kaufen kann. Ernüchternd, dass jeder glaubt, dass darin die Freiheit besteht.
Was empfinden Sie heute als Freiheit?
Alles, was ich, als Europäerin, einen deutschen Pass in der Tasche, hier nennen könnte, ist ein Privileg. Solange an den Grenzen Europas Gewalt ausgeübt wird, um die Freiheit im Innern zu erhalten, erscheint mir das Wort zweifelhaft.
„Jeder Mensch ist Einzelwesen und zugleich Menschheit.“
Katharinas Vater schätzt Hans als Schriftsteller, weil dieser „sich selbst zum Material macht und historisch denkt“. Wie sehen Sie diese Haltung?
Jeder Mensch ist Einzelwesen und zugleich Menschheit. Hat seine private Geschichte, die sich aber immer auch in einem historischen Kontext lesen lässt. Daraus ergeben sich Verwerfungen, die mich interessieren.
Für Ihre „Geschichte vom alten Kind“ wollten Sie Wirklichkeitserfahrung gewinnen und haben sich mit 27 als Schülerin in eine Klasse gemogelt. Gab es für Ihren neuen Roman ähnliche Aktionen oder Rechercheeinsätze?
Bis auf die Besuche in Archiven und die Erschütterungen, die dadurch eintraten – nein.
Den Wandel in der Wendezeit schildern Sie etwa am Beispiel von Hans und seinen Kollegen beim staatlichen Rundfunk und Fernsehen der DDR. Wie haben Sie selbst diese Umbruchzeit erlebt? Was ist Ihnen als gravierendste Erfahrung in Erinnerung?
Wie schnell ein ganzer Staat abhandenkommen kann. Mit seiner Produktionsweise, seinen Besitzverhältnissen, seinen Sitten, seiner Kultur, seinem Vokabular.
Viel später ist Katharina mit dem Nachlass der gemeinsamen Jahre 1986 bis 1992 konfrontiert. Worin sehen Sie die größte Herausforderung, vor die Sie Ihre Protagonistin stellen? Und was spielen dabei Kairos und Chronos für Rollen?
Der Tod stellt alte Fragen noch einmal neu – und anders. Aus dem Jenseits einer alten Geschichte, aus über 30 Jahren Abstand werden plötzlich Strukturen sichtbar. Der glückliche Augenblick ist eine Wahrheit. Die Jahre nach dem glücklichen Augenblick sind auch eine Wahrheit. Beides ist von Gewicht.
Ihr Roman weckt die unterschiedlichsten Assoziationen, etwa an die Wucht griechischer Dramen / Tragödien. Was schwebt Ihnen vor?
Hinter die Oberfläche des Spiegels gelangen.
Nicht nur wegen der vielen musikalischen Anspielungen könnte man Ihren Roman als literarisches Requiem verstehen. Wäre das in Ihrem Sinn?
Ja, absolut.
Was hat hier für Sie am meisten Gewicht? Abschied oder Erinnerung? Versöhnung mit der Vergangenheit oder Jüngstes Gericht?
Ein Requiem hat doch immer mehr mit den Lebenden zu tun als mit den Toten. Wer nach dem fragt, was war, fragt im Grunde genommen immer nach dem, was sein wird und kann.