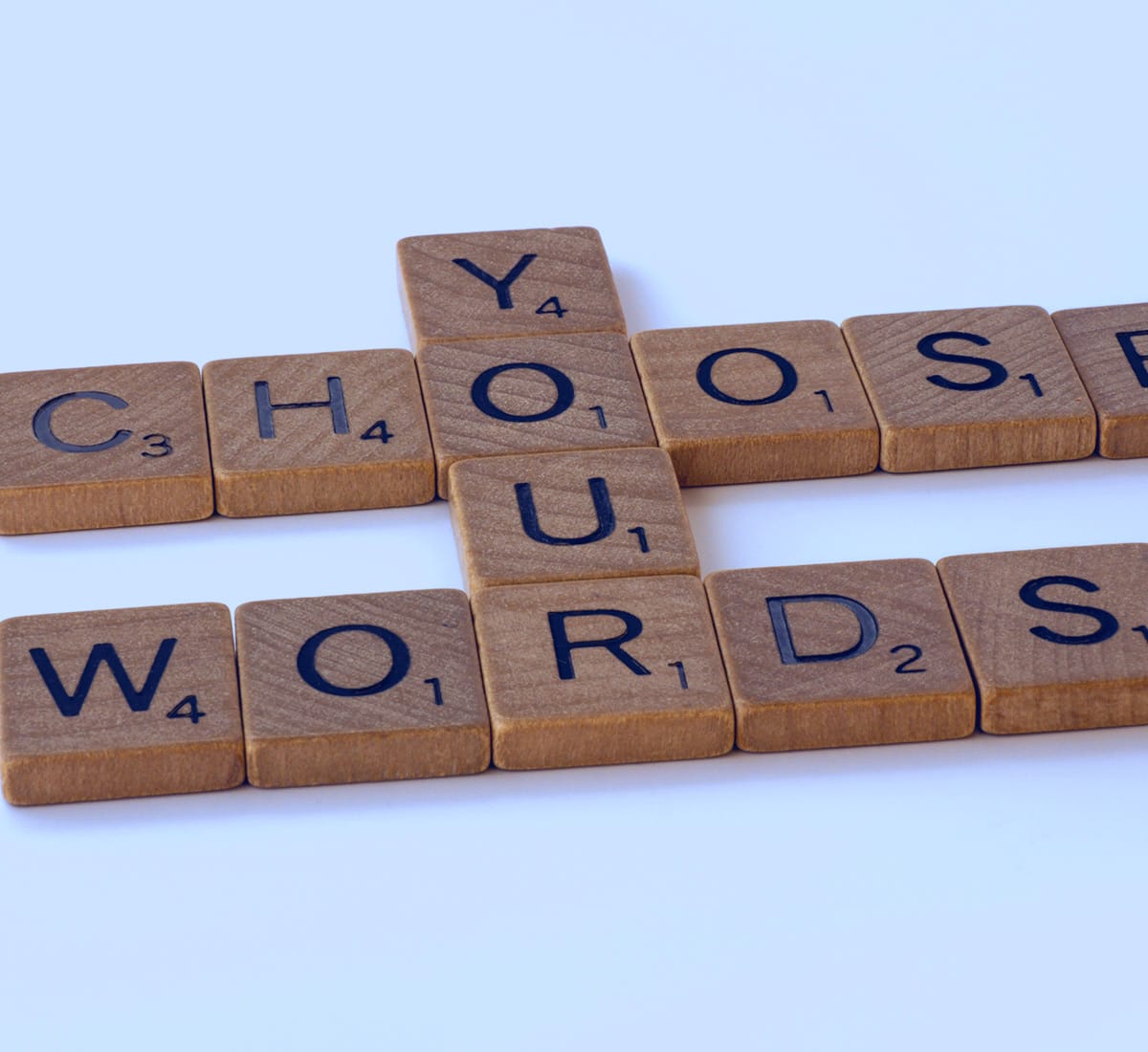

Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 180 Lesepunkte sammeln
180 Lesepunkte sammeln
ZUGEGEBEN, „Das Tuch“ hat immer wieder für Aufregung gesorgt – als gleichnamige Kolumne und als Kopfbedeckung. Nicht jeder vermutet in der Trägerin eine der 2016 gekürten „25 Frauen, die unsere Welt besser machen“. So weiß Kübra Gümüsay, wie schnell Menschen auf Kategorien reduziert werden. Das zu ändern, hat die preisgekrönte Journalistin, Bloggerin und politische Aktivistin zu ihrer Mission gemacht – für ein gleichberechtigtes Miteinander und einen Austausch auf Augenhöhe durch eine neue Sprachkultur.
Ob „Humankapital“ 2004, „Herdprämie“ 2007, „Opfer-Abo“ 2012 oder „alternative Fakten“ 2017: Seit 1991 wird in einer von dem Sprachwissenschaftler Horst Dieter Schlosser ins Leben gerufenen Aktion das „Unwort des Jahres“ ermittelt. Wie würde Ihr aktueller Favorit für dieses Negativ-Ranking lauten?
„(Linkes) Meinungskartell“ wäre ein guter Kandidat. Das Wort suggeriert, dass es nur eine begrenzte Reihe an Meinungen geben dürfe – und alles außerhalb des Kartells würde ausgeschlossen werden.
Und Ihr persönliches „Wort des Jahres“?
Ambiguitätstoleranz. Der Begriff stammt von Thomas Bauer, aus seinem Buch „Die Kultur der Ambiguität“, und bezeichnet die Fähigkeit, damit leben zu können, dass viele Dinge nun einmal nicht eindeutig sind und dass es auf viele Fragen keine absoluten, universellen Antworten gibt. Thomas Bauer hat mit seinem Buch „Die Kultur der Ambiguität“ einen fantastischen Aufschlag gemacht …
Wie finden Sie solche Initiativen, die auf sprachliche Sensibilisierung abzielen?
Häufig werden sie als belanglose, nebensächliche Initiativen abgetan, die dabei die Realität vernachlässigen. Dabei ist Sprache mächtig, sie prägt unser Denken und unser Miteinander ganz wesentlich mit. Deshalb begrüße ich solche Initiativen, denn sie können dazu beitragen, unsere Gesellschaft gerechter, freier, friedlicher zu machen. Sprachliche Sensibilisierung ist selbstverständlich kein Garant für eine gerechte, friedliche Gesellschaft. Unterdrückende, diskriminierende, ächtende Sprache steht dieser aber garantiert im Weg.
„Sprache ist nicht nur einfach ein Werkzeug.“
Sie zitieren George Steiners Gedanken über die unmenschliche Sprache der Nationalsozialisten. Automatisch denkt man da an Viktor Klemperer, der schon um 1934 in Tagebuchnotizen Pläne machte zu einer Untersuchung der Sprache und des Geistes oder Ungeistes, der sie vergiftet. Daraus entstand „Lingua Tertii Imperii“, also „Sprache des Dritten Reiches“. Ebenfalls sehr bekannt wurde „Aus dem Wörterbuch des Unmenschen“. Was versprechen Sie sich von solchen Analysen?
Klemperer und Steiner haben beide festgehalten, dass und wie die Sprache von Ideologie, Hass und Entmenschlichung durchzogen ist. Spannend an Steiners Arbeit ist, wie stark sich diese Prägung auch nach dem Ende des Dritten Reiches noch gehalten hat. Das sind wichtige Analysen, die uns helfen zu verstehen, dass unsere Sprache nicht einfach nur ein Werkzeug ist, sondern vielmehr eine Struktur, eine Architektur, die auch Relikte der Vergangenheit in sich tragen kann.
Was hat Ihr intensives Interesse an den unterschiedlichsten Facetten von Sprache ausgelöst?
Mehrsprachig zu sein, zwischen Sprachen hin- und herzuwandern, war der erste Grund. Doch als ich nach einigen Jahren in Großbritannien zurück nach Deutschland zog, spürte ich in den politischen und gesellschaftlichen Diskursen eine solche Enge und Destruktivität, dass ich das Gefühl hatte, nicht mehr sprechen zu können. Denn die Debatten erschienen mir sinnlos … Stattdessen wollte ich so tief tauchen, dass ich an eine Struktur stoße, an der es sich lohnt zu arbeiten, um ein konstruktives, menschliches Sprechen und Diskutieren zu ermöglichen. Und diese Struktur habe ich in der Architektur unserer Sprache gefunden und in der Art, wie wir – als Gesellschaft – miteinander diskutieren.
Und wie würden Sie Ihren aktuellen Befund auf den Punkt bringen? Was löst Unbehagen bei Ihnen aus?
Wenn wir unsere gegenwärtigen öffentlichen Diskurse betrachten – ob nun zum Thema Ökologie, Integration oder Geschlechtergerechtigkeit – dann sehen wir: Wir kommen nicht zusammen, um diese Themen voranzutreiben, um konstruktiv und zukunftsgewandt zu diskutieren, sondern um jeweils vermeintlich absolute Wahrheiten zu postulieren, die gegeneinander antreten, und um die Gunst des Publikums zu buhlen. Wie aber soll eine Zivilgesellschaft nachhaltig funktionieren, wenn sie nicht an öffentlichen Denkprozessen teilhaben kann? Wenn suggeriert wird, es gäbe nur eine kleine Auswahl an abgeschlossenen Antworten, zwischen denen wir wählen können? Das ist fatal. Was macht das mit uns? Mit den nachkommenden Generationen? Wie sollen wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, wenn wir permanent damit beschäftigt sind, Haltung zu zeigen oder an Schlagabtauschen beteiligt sind? Statt aufeinander zu hören, uns wirklich miteinander auszutauschen?
Im Inhaltsverzeichnis sticht natürlich als Kapitelüberschrift „Die intellektuelle Putzfrau“ hervor.
Nach Jahren, in denen ich mich an den medialen Diskursen zu den Themen Sexismus, Rassismus, Migration, Islam & Co beteiligte, wurde mir zunehmend klarer, dass ich nichts anderes war als eine intellektuelle Putzfrau. Und damit Teil eines destruktiven Systems. Und das geht so: Irgendjemand stellt hanebüchene, entmenschlichende oder verfassungsfeindliche Thesen in den Raum. „Oh, spannend“, heißt es dann. „Das müssen wir jetzt diskutieren!“ Und so werden Menschen wie ich in diese Runden geladen, um ihnen intellektuell hinterherzuräumen, die Scherben zusammenzufegen. Sie behaupten etwas Absurdes und wir sind damit beschäftigt, auf sie zu reagieren. Wir müssen versuchen, den Schaden einzugrenzen. Doch letztlich geben sie vor, womit wir uns beschäftigen, zu welchen Themen wir uns Gedanken machen, Zeit, Wissen und Intellekt investieren.
„Keine Sprache kann die Welt in Gänze abdecken.“
Ihr druckfrisches Buch beginnt mit poetisch anmutenden Eindrücken, z.B. mit der Spiegelung des Mondscheins auf dem Meer und mit Sonnenlicht, das durch Baumkronen schimmert. Welche Möglichkeiten möchten Sie da bewusst machen?
Die Welt ist groß, facettenreich, voller ungelöster Geheimnisse und unerforschter Bereiche. Keine Sprache kann sie in Gänze abdecken. Es geht letztlich auch darum zu lernen, mit Demut und Neugier durch die Welt zu gehen. Sie zu ergründen. Denn das Ende unseres Horizonts ist nicht das Ende der Welt.
Ziemlich am Anfang Ihres Buches zitieren Sie Wilhelm von Humboldt. Die Quintessenz? Und inwiefern passt das gut zu Ihren Beispielen, die von den Pirahã am Amazonas und den nordaustralischen Thaayorre bis zu uns heute in Mitteleuropa reichen?
Humboldt schrieb einst, in jeder Sprache liege eine „eigenthümliche Weltsicht“. Wenn wir die unterschiedlichen Sprachen betrachten, dann sehen wir das beispielhaft: Nehmen wir die Thaayorre, die in ihrer Sprache kein rechts und links verwenden, sondern die Himmelsrichtungen, um sich zu orientieren. Selbst im Alltag oder auch in geschlossenen Räumen. Sie nehmen Zeit anders wahr als wir. Wenn Sie als Deutschsprachige zum Beispiel Bilder eines Menschen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter anordnen würden, würden sie es von links nach rechts tun. Für uns fließt die Zeit nämlich von links nach rechts, weil wir so schreiben. Für Arabisch- oder Hebräisch-Sprachige läuft die Zeit dementsprechend von rechts nach links. Für die Thaayorre ist sie jedoch abhängig davon, wie sie auf der Welt stehen. Denn für sie läuft die Zeit von Osten nach Westen. Dieses Beispiel zeigt mir, wie „eigenthümlich“ eigentlich unsere Sicht auf die Welt ist. Die Zeit dreht sich mit uns, egal wohin wir uns drehen. Wir stehen im Zentrum unserer Welten. Wie würden wir anders leben, denken, die Welt wahrnehmen, wenn wir im Bewusstsein leben würden, dass wir nichts anderes sind als ein kleiner Punkt auf einer Landkarte?
„Möchte(n) ich, wir so leben?“
Sie analysieren nicht nur die Sprache der Anderen, sondern auch Ihre eigene Ausdrucksweise. Was wollten Sie in eigener Sache ergründen?
Ich wollte ein Gefühl für die Architektur unserer Sprache bekommen, sie ertasten und so gut es geht verstehen. Um zu ergründen, weshalb wir so leben, erleben und sehen, wie wir es tun. Aber auch, um dann einige Schritte zurückzutreten und mich zu fragen: Möchte ich so leben? Möchten wir so leben?
Sie schildern an unterschiedlichsten Beispielen, wie es sich auswirken kann, zwischen den Sprachwelten zu wechseln. Was war für Sie das Interessanteste an den Erfahrungen von Jhumpa Lahiri, Navid Kermani und anderen?
Das Spannende bei der Recherche an diesem Buch war, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch überall in der Geschichte der Literatur Menschen zu finden, die zwischen Sprachen hin und herwanderten, an den Gräben zwischen den Sprachen verzweifelten, sich erdrückt fühlten, aber auch sich emanzipierten und Brücken bauten. Für mich waren diese Geschichten wie Diamanten: Nelly Sachs, James Baldwin, Paul Celan und viele andere. Ihre Geschichten sagen viel über unser Heute aus. Wir können von ihnen lernen.
„Wir sollten ein Bewusstsein für die Macht der Sprache erlangen.“
Sie schreiben: „Sprache ist mächtig. Und Macht bedeutet Verantwortung.“ Wie würden Sie diese Erkenntnis in ein Gebot – für den Alltag – übersetzen?
Wenn wir ein Bewusstsein für die Macht eines Instrumentes erlangen, dann verwenden wir es anders. Umsichtiger, rücksichtsvoller, demütiger — für die Umwelt, aber auch uns selbst. Das ist es übrigens auch, was ich mir für unsere gesellschaftlichen Debatten wünschen würde.
Hinter sprachlichen Verfehlungen steckt nicht immer böse Absicht. Wie können wir uns Ihrer Vorstellung nach das Miteinander leichter machen?
Wenn wir in einer Beziehung einem Menschen ohne böse Absicht wehtun, dann häufig, weil wir einen Sachverhalt oder eine Situation nicht aus ihrer, sondern unserer eigenen Brille betrachtet haben. Nun ist die Frage: Beharre ich auf meiner Brille und erkläre sie zur einzig richtigen Wahrnehmung? Oder lasse ich mich auf die Brille eines anderen Menschen ein und lebe also mit dem Bewusstsein, dass ich ein einzelner Mensch bin, der wie alle Menschen nur eine begrenzte Wahrnehmung hat? Wer in diesem Bewusstsein durch die Welt geht, bereit zu lernen und sich für die Perspektiven anderer zu öffnen, der wird mit einer solchen Kritik anders umgehen – wird aber auch anders kritisieren.
Und was tun Sie selbst, wenn Sie feststellen, dass Sie Ihr Gegenüber durch die falsche Wortwahl verletzt haben?
Ich sehe Kritik an der Wortwahl als Gelegenheit zu lernen, zu wachsen, eine neue Perspektive einzunehmen – und bin sehr dankbar dafür, dass sich jemand die Mühe macht, mir dabei zu helfen, umsichtiger zu werden. Solche Situationen können ein Geschenk sein. Wenn die Kritik an der eigenen Sprache auf manchmal scharfe Art und Weise vorgetragen wird, ist es natürlich schwer, dort die Lehre herauszuarbeiten. Aber es lohnt sich oftmals trotzdem.
„Wir alle sind ständig im Wandel.“
An Ihrer Erfahrung mit dem Film „Moonlight“ zeigt sich, dass man andere Lebenswelten auch bei gutem Willen und Offenheit nicht immer auf Anhieb versteht. Der erste Schritt in eine positive Richtung?
Ja, aber das sollte ja eigentlich der Normalzustand sein. Wir verstehen die Welt nicht. Wir verstehen Menschen nicht, uns selbst nicht. Zumindest nicht abschließend. Denn wir alle sind ständig im Wandel, komplex, vielschichtig und facettenreich. Das ist doch der Reiz am Leben: das Nichtverstehen, aber etwas mehr in Erfahrung bringen zu wollen. „Ambiguitätstoleranz“, sozusagen.
Und wie, glauben Sie, ließe sich diese Idealvorstellung vom neuen Sprechen im Alltag von möglichst vielen umsetzen?
Wir brauchen neue öffentliche Räume, in denen wir zugewandt und konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen. In denen ein Fehler ein Gewinn für alle ist, weil es – frei nach David Bohm – keine Gewinnenden und Verlierenden gibt, sondern weil durch einen Erkenntnisgewinn, wie beispielsweise durch Fehler, alle gewinnen. Damit wir aber zugewandt, selbstkritisch und bereit, uns selbst zu hinterfragen, in einen Raum gehen können, muss der Rahmen dieses Raumes klar gesteckt sein. Mit Extremisten, Menschenfeinden oder Absolutisten funktioniert ein zugewandtes, konstruktives, offenes Gespräch, öffentliches Denken nicht.





