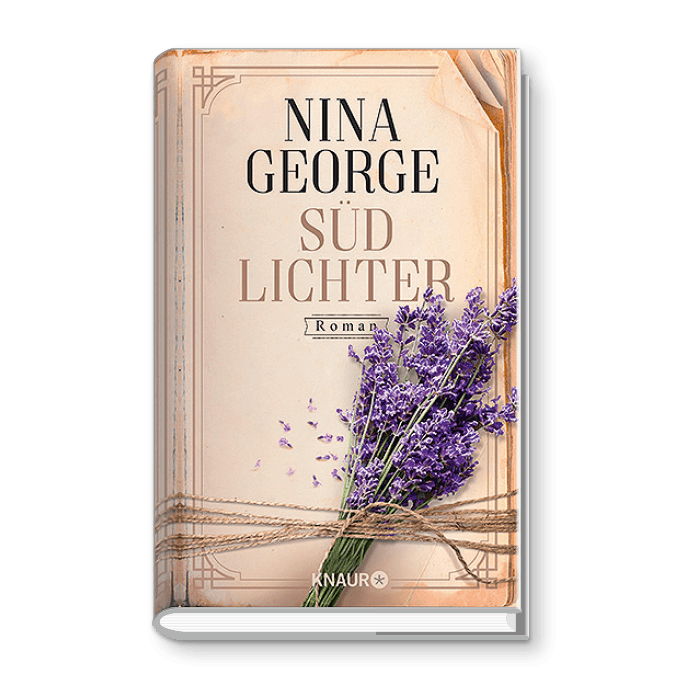Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 190 Lesepunkte sammeln
190 Lesepunkte sammeln
AUF WUNDERBARE WEISE hat sich der Wunsch einer vielstimmigen Leserschaft erfüllt. Nina George ist tatsächlich das große Kunststück gelungen, an ihren Welterfolg „Das Lavendelzimmer“ anzuknüpfen und ebenso viel Zauber zu entfalten – indem sie in ihrem neuen Buch den Schatz aus ihrem Bestseller hebt: Aus der „Literarischen Apotheke“ von Monsieur Perdu hat das Herzstück mit der optimalen Dosis Glück nur darauf gewartet, erzählt zu werden: „Südlichter“ ist die Geschichte von Sternschnuppennächten und sonnendurchfluteten Sommertagen in der Provence, wo Schicksale besiegelt werden – durch die Liebe und durch die Literatur. Lebendige Charaktere, feinste Psychologie, reinste Poesie!
Wie schon „Das Lavendelzimmer“ ist auch Ihr druckfrisches Buch „Südlichter“ durchflutet von französischem Flair. Was macht Ihr Frankreich-Faible aus?
Ein gutes Essen in angenehmer Gesellschaft, mit viel Gelächter und in einer duftenden Umgebung. Frankreich, das ist für mich der ausgeprägte Sinn für Gemeinschaft, sich Zeit füreinander zu nehmen, es sich in einem Winkel der schnellen, anstrengenden Gegenwart mit Sorgfalt schön zu machen. Letztlich besteht das Leben in Summe aus jenen Stunden, die wir mit Freundinnen und Lieben erlebt haben.
Was ist Ihr Ritual, wenn Sie in Ihrem französischen Domizil ankommen?
Auf dem Weg in mein kleines Hafenstädtchen gegenüber des Glénan-Archipels einen kurzen Halt bei der Cabane de Coquillage in Kerdruc machen und 24 Fluss-Austern mitnehmen; sie werden kaum zwölf Euro kosten. Vor Ort alle Fenster und Türen zur Meerseite hin aufreißen, über die wilde Wiese zum Plage de La Baleine hinunter laufen, Schuhe ausziehen, Hosenbeine hochrollen und dem Atlantik mit den baren Zehen Bonjour sagen. Atmen. Sehr tief ein- und ausatmen.
Das Lavendelzimmer steht für die große, verlorene Liebe von Monsieur Perdu. Zur Rettung für ihn und viele andere wird seine „Literarische Apotheke“ mit rund 8.000 Büchern. Welche Bedeutung haben Bücher für Sie selbst?
Ich halte es mit Gustave Flauberts Diktum: Lesen, um zu leben. Aus Büchern lernte ich alles über Menschen, Gesellschaften, Geschichte, Zukunft, Intimitäten, Liebe, Hass oder Freundschaft. Ich sehe Bücher deswegen für Kinder und Jugendliche als so nötig an wie Essen und Elternliebe. Um ihnen dabei zu helfen, sie selbst zu werden und sich als Teil einer emotionalen Werteheimat zu begreifen. Oder gar Rettung in Büchern zu finden. Bei mir war es 2012 „Die Eleganz des Igels“ von Muriel Barbery in der Übersetzung von Gabriela Zehnder, das mich endlich zum Weinen gebracht hat – nachdem ich ein Jahr in tränenloser Schockstarre nach dem Tod meines Vaters verbracht hatte. Der Roman war, wie es Kafka sagte, die Axt für das gefrorene Meer in mir.
„Rettung in Büchern finden.“
Mit Sensationserfolgen ist es so eine Sache, wie Sie einst am Beispiel von Max Jordan im „Lavendelzimmer“ geschildert haben. Wie ist Ihre eigene Erfahrungsbilanz?
Ich musste mich nach dem völlig überraschenden Erfolg – hey, was hatte ich bloß richtig gemacht?! – bewusst entscheiden: Schließe ich die folgenden Romane thematisch, örtlich, emotional an, um das Erreichte nicht auf’s Spiel zu setzen – oder bleibe ich bei dem Versprechen: Ich will schreiben, was ich will? Ich habe mich für das Risiko entschieden und mit „Das Traumbuch“ und „Die Schönheit der Nacht“ zwei völlig andere Geschichten erzählt, realistischer, schmerzhafter. Gleichzeitig bin ich Monsieur Perdu dankbar. Er hat mir mit dem finanziellen Polster ermöglicht, Mut zu haben. Mut, nach Frankreich zu ziehen, Mut, mich auf politischen Aktivismus einzulassen. Und auch Demut habe ich gelernt: Ich danke auf den Knien meiner Seele den Buchhändlerinnen und Leserinnen, dass ich erleben durfte, in 37 Sprachen gelesen zu werden. Ich bin sehr demütig ob dieser Größe. Sie ist unfassbar, mehr noch: Sie ist unwiederholbar.
Während die Öffentlichkeit ihn als neuen Star der Literaturszene und als „zornige Stimme der Jugend“ feiert, ist Max abgetaucht und verstummt. Ihn hat das Schriftsteller-Schreckgespenst Schreibblockade heimgesucht. Sind Sie selbst immun gegen die Furcht, dass Ihnen nichts mehr einfällt?
Mir fällt nie nichts ein. Die Herausforderung ist, sich zu entscheiden: Was davon will ich erzählen, was „reicht“ für 300 Seiten? Und wie kann ich es erzählen, sind meine erzählerischen Instrumente dafür gereift? Das „wie“ bringt mich oft an den Rand einer scharfkantigen Verzweiflung, ich verletze mich an Frust, Angst, Unfähigkeit, genau den Ton, den Rhythmus, zu finden, der sich richtig anfühlt. Ich beginne oft in „ich“-Form, um den Figuren und ihren inneren Dramen nah zu kommen. Und auf einmal geht’s.
Monsieur Perdu verabreicht dem verzweifelten Max das für ihn selbst wichtigste Werk aus seiner „Literarischen Apotheke“: das einzige Buch von Sanary – ein Pseudonym. Was symbolisiert dieser Name für Sie?
In Sanary-sur-Mer kamen in den 30er- und 40er-Jahren nicht nur verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller unter. Für mich war es der Heilort, an dem ich mit dem Leben und dem Tod Frieden schließen konnte, nachdem mein Vater gestorben war. Entsprechend ist „Sanary“ für mich ein Trostbegriff, ein Ankommort in mir selbst.
„Ach, meist war es Notwehr!“
Sie selbst veröffentlichen unter mehreren Pseudonymen. Warum? Ist das ein bisschen so wie bei den Heteronymen von Fernando Pessoa?
Ach, meist war es Notwehr! Das erste Pseudonym, Anne West, wählte ich 1997, um dem Veröffentlichungsverbot meines damaligen Chefredakteurs einer konservativen Zeitschrift zu entgehen. Nina Kramer entstand aus der simplen Tatsache, dass ich in einem Jahr einen Entwicklungsroman und einen Wissenschaftsthriller geschrieben hatte und die beiden Verlage kein Konkurrenzgerangel um den besten Platz im Ladenregal haben wollten. Jean Bagnol war die Vermählung von zwei Schreibköpfen, meines Mannes Jens J. Kramer und meinem, zu einem Experiment: Unsere Provencekrimis sollten sich selbst und ohne Nimbus des Lavendelzimmers am Markt durchschlagen, oder eben auch in Würde scheitern. Wir suchen gerade nach Zeitfenstern, um die nächsten drei Serienteile zu schreiben …
Für Schlagzeilen beziehungsweise Empörung hat zuletzt der Enttarnungshype um Elena Ferrante gesorgt. Wie ist Ihre Haltung in solchen Fällen? Enthüllen oder Geheimnis wahren?
Jedes Werk spricht für sich, und dann mit der Leserin. Ein Buch öffnet den inneren, intimen, individuellen Resonanzraum; im Prinzip beginnt jedes gute Buch eine Unterhaltung mit seinem Leser. Wozu also ist es nötig, den Autoren, die Schriftstellerin mitzudenken – wenn das Wesentliche doch zwischen Buch und Rezipientin stattfindet? Also, klar: Geheimnis wahren. Vielleicht ist Frau Ferrante ein Mann. Würde das etwas an der Unterhaltung mit sich selbst ändern? Ich lese gerade Ferrantes Buch über das Schreiben. Es ist so intim und ehrlich. Beneidenswert: Ich glaube, wäre ich anonym, würde ich noch intimer schreiben. Auch das spricht für das Geheimnis: Geben wir dieser Stimme die Chance, weiterhin so rücksichtslos ehrlich zu sein.
Sanarys Werk „Südlichter“ wird mehrfach im „Lavendelzimmer“ erwähnt. Wie konkret war damals schon Ihr Plan, aus dem „Buch im Buch“ tatsächlich ein eigenständiges Werk zu erschaffen?
Ich hatte die diffuse Idee eines Buches, das aus der Sicht der Liebe über die Menschen erzählt. Um auf diese Weise dem Buchhändler Perdu die Chance zu geben, sich selbst zu verzeihen. Er wählte, ein geheimer Liebhaber zu sein, der seiner großen Liebe nie die Größe seiner Zuneigung zumutete, um sie nicht zu quälen. Schon damals wünschte ich mir, aus der Sicht der Liebe zu schreiben – eines Tages.
Welche Rolle hat das internationale Publikumsecho gespielt?
Ohio, Rio de Janeiro, Ankara, Johannisburg, Athen … nach und nach erreichten mich schüchterne, empörte, irritierte Briefe, wo verflixt noch eins dieses Südlichter-Buch zu finden sei! Letztlich fiel die Entscheidung … in Sanary-sur-Mer! 2018, am Geburtstag meines Mannes. Als ich, umfangen von der Schönheit des Südens, fern von allen drängenden Verwerfungen der Politik und des Alltags sagte: „Ich bin es so leid, über Leid zu schreiben. Es ist zu viel Schmerz in der Realität. Ich will so gerne über das hier schreiben: Duft, Süden, Geborgenheit. Ich will ein Buch, in dem ich mich verstecken könnte und keine Angst haben müsste, dass etwas Grauenhaftes passiert. Ich würde so gerne über Liebe schreiben.“ Und er sagte trocken: „Ja, mach doch.“ Abgesehen davon gaben mir Bettina Halstrick vom Giraffenladen und Andreas Meyer von Verlagsconsult den letzten kleinen liebevollen Tritt. Also machte ich.
Ziemlich am Anfang von „Lavendelzimmer“ philosophiert Monsieur Perdu auf einer Bank am Seine-Ufer mit einer alten Dame, dass endlich einmal jemand eine Art „Gefühlsenzyklopädie“ verfassen müsste – ein „Lexikon der Allerweltsgefühle“ mit Begriffen wie „Enkeltrost“ und „Fremdvertrauen“. Was wären heute Ihre drei wichtigsten Neuaufnahmen?
Eckenneugier (man muss unbedingt noch um die nächste Ecke schauen und geht immer weiter …). Viertgefühl (eine Gemütsbewegung, die nicht Liebe, Verliebtheit oder Begehren ist, sondern ein unbekanntes, brausenderes Gefühl). Buchhunger (man wird sonst wahnsinnig vor Gehirndurst).
„Gibt es die Eine große Liebe überhaupt?“
Entspringt „Südlichter“ der im „Lavendelzimmer“ anklingenden Idee einer „Gefühlsenzyklopädie“ ?
Es ist mehr eine Betrachtung der verschiedenen Sorten der Liebe… eine kleine Liebes-Enzyklopädie.
Und wie hat Monsieur Perdus eigenes Gefühlsdrama / seine fragile Überlebensstrategie die Entstehung von „Südlichter“ beeinflusst?
Ich habe aus der Sicht der Erzählerin hinter Sanary gedacht, mich in eine Frau Anfang Zwanzig hinein versetzt. Die sich fragt: Gibt es die Eine Große Liebe überhaupt? Und wenn: für mich auch? Und wenn ja: wo verflixt noch mal steckt sie bloß?! Und die darüber schreiben will, um die Große Liebe auf sich aufmerksam zu machen. Also schon wieder Notwehr gegen das ignorante Schicksal!
„Südlichter“ führt uns ins eher ländliche Frankreich. Wie haben Sie die Schauplätze ausgewählt?
Magie findet oft an vergessenen Orten statt. Das Hinterland der Côte Bleue, an den Ausläufern der Alpen, ist so ein vergessener Ort. Ich suchte nach einem Schauplatz, der universell für Dörfer auf der ganzen Welt stehen kann, die ihre eigenen Regeln und engen Verbindungen zwischen Menschen besitzen, und aufgrund ihrer relativen Abgeschiedenheit Raum für Märchenhaftes besitzen. Kraftvolle Natur. Weite Himmel. Dazu benötigte ich genau die Drôme Provençale. Und wehe, da fahren jetzt alle hin! (Fahren Sie nach Nyons).
Perdu ist kein gewöhnlicher Buchhändler, sondern ein begnadeter Psychotherapeut – oder mit seinen Worten: Seelenvermesser. Wie würden Sie die besondere Gabe nennen, die Sie der „Südlichter“-Heldin Marie-Jeanne in die Wiege gelegt haben?
Marie-Jeanne versteht die Liebe und sieht sie in jedem Winkel des Alltags, doch solange wir die Liebe verstehen, können wir uns nicht in ihr verlieren …
Die erste Schicksalsstunde erlebt Marie-Jeanne als Winzling in einem Weidenkörbchen – aber nicht wie der biblische Moses im Schilf, sondern unter einem Olivenbaum. Wie würden Sie jenseits der Botanik seine Besonderheit erklären?
Ich habe mir im Manuskript einen längeren philosophischen Ausflug erlaubt, warum Bäume bestimmter Lebensalter die Chronik der Menschheit sind. Ich liebte als Kind die Sagen und Legenden der Griechen und Römer, und habe mir als 2019er-Autorin gegönnt, mich tief verwurzeltem Naturglauben anzunähern und davon – hoffentlich! – amüsant zu erzählen, warum Bäume alles über uns wissen.
„… einen Unterschied im Leben machen.“
Die verwaiste Marie-Jeanne bekommt als Pflegeeltern ein gegensätzliches Paar: Elsa und Francis. Warum und wie haben Sie die beiden ausgesucht?
Es gibt sie, diese Paare, die in Dysfunktionalität fest verbunden sind. Da mein Leitgedanke war, über die verschiedenen Sorten der Liebe zu erzählen, gehört die kratzbürstige Elsa, die ihre Zuneigung mit Strenge tarnt, genauso dazu wie Francis, dessen Pragmatismus die Liebe zu einer Tätigkeit macht: Die Tat besteht darin, seine Frau so zu lassen, wie sie ist. Vermutlich das größte Liebeswerk, das jemand vollbringen kann!
Wem oder was verdankt Francis, dass er seine Berufung findet?
Es gibt eine Stelle in der Geschichte, in der Francis die innige Sehnsucht befällt, „einen Unterschied im Leben zu machen. Kein Feigling zu sein.“ Jean-Paul Sartre spielt dabei eine versehentliche Rolle, ein kleines Mädchen mit einer hinreißenden Idee des Büchertauschens, und Francis´ Neugier, was in diesen komischen Büchern wohl steht, was ihm das Leben bisher unverschämterweise vorenthalten hat.
Neben der Geschichte von Elsa und Francis erzählen Sie noch eine Reihe weiterer Schicksale. Was verbindet die einzelnen Schicksale?
In meiner Arbeitskladde zu „Südlichter“ habe ich fünfzehn, zwanzig Biographien. Es gibt so viele Figuren, die nicht auftauchen; wie der Mann, der auf einmal Pensionär ist und feststellt: Er hat die Welt nie wirklich gesehen. Oder die Geschichte der fünfzehnjährigen Pariserin, die zum ersten Mal am Meer ist und sich fragt, wer sie eines Tages werden könnte, wenn sie nur erstmal verstünde, wer sie überhaupt schon ist … ich habe immer einen großen, zutiefst freundschaftlichen Bezug zu meinen Menschen. Und das Verzehren nach Geliebtwerden, nach Liebegeben, sehe ich als jene Verbindung, die Menschen in Büchern und auch Menschen außerhalb von Büchern mit einander verknüpft. Wir alle müssen damit leben, ein Wesen mit Gehirn und gleichzeitig mit einer Sehnsucht zu sein, die den Verstand relativ lästig findet.
Manche Kapitel haben Sie mit einem Fingerzeig-Symbol versehen. Welche Überlegung hatten Sie dabei?
Ich liebte die Dramaturgie von „Die Bücherdiebin“ von Markus Zusak in der Übersetzung von Alexandra Ernst, wo Einschübe außerhalb des Erzählflusses eine Nebenmelodie spielen, die die Zentrumserzählung abrundete. Gleichzeitig machte es so viel Schreibfreude, meine inneren Zwischenrufe zu formulieren, so, als ob eine Gruppe Fremder sich nachts im Zugabteil in Richtung Süden über die Liebe und ihre merkwürdigen Ausformungen unterhält. Und am Ende sehr vertraut miteinander ist.
„Liebe ist. Das ist das einzig Sichere.“
Eines der großen Rätsel in „Südlichter“ ist die Frage, was es mit der Liebe auf sich hat. Sind Sie dem Geheimnis beim Schreiben oder im Leben näher gekommen?
Ich halte es mit Francis, der sagt: „Liebe ist. Das ist das einzig Sichere, was wir über sie wissen.“
In „Südlichter“ entfaltet nicht allein die Liebe schicksalhafte Wirkung, sondern es konkurrieren verschiedene Kräfte von der Angst bis zu Logik und Vernunft. Manchmal erscheinen sie wie ein Koboldspuk in Shakespeares „Sommernachtstraum“ oder ein Wüten der olympischen Götter. Wer oder was führt da eigentlich Ihrer Vorstellung nach die Regie?
Das Chaos. In Büchern haben wir die seltene Gelegenheit, als Schriftstellerinnen das Schicksal unter Kontrolle zu halten. Und nur dort. Das Chaotische des Lebens abzubilden erschien mir in Form der Zwischenrufe der Logik, der Angst, der irritierenden Lust, als angemessen, um kurz daran zu erinnern, dass das Menschsein eine absurde Abfolge von Gemütsregungen, Zufall, innerem Zwist und herrlichen Dämlichkeiten ist. Ich meine, wie oft piepst die Vernunft schüchtern dazwischen, wenn wir eine unmögliche Beziehung eingehen oder eine herrlich fatale Entscheidung treffen – und wir hören diese Stimme im Kopf, aber achten nicht auf ihre Interventionen, weil die Neugier juchzt: „Ist mir egal, man lebt nur ein Mal – vermutlich?“ Wir sind vermutlich voll von einer riesigen inneren Konferenz an Kobolden und Göttern.
Ob „Das Lavendelzimmer“ oder nun „Südlichter“: Eine Schlüsselrolle kommt Büchern zu – und zwar den klassischen gedruckten Büchern. Was ist für Sie – auch und gerade jetzt im digitalen Zeitalter – das Faszinierende daran? Welche Wirkung trauen Sie Büchern zu?
Bücher und ihre Autorinnen haben die Aufgabe, die Menschheit davor zu bewahren, sich selbst auszurotten. Ganz gleich, in welcher technischen Evolutionsepoche wir gerade stecken. Als Gegenentwurf zum Headlinegeschnatter des Internets können Bücher aber noch mehr: Fluchtort sein, Identitätsspiegel, der nicht verzerrt wird durch Likes und Selfiegetue. Wer Bücher liest, egal ob digital oder gedruckt (Hier möchte ich die Trägermedien gar nicht gegeneinander ausspielen!), sich selbst und die Welt damit durchdringt, geht auch nicht so schnell Meinungsmachern und Fehlbehauptungen auf den Leim. Kein Wunder, dass in restriktiven Gesellschaften Bücher meist als erstes von Diktatoren verboten werden. Sie sind einfach zu gefährlich für Tyrannen.
Ein Reich aus Büchern haben Sie Ihrer Romanheldin Colette erschaffen. Welche Lebensphilosophie steht dahinter? Und wie ist es mit den Risiken und Nebenwirkungen bestellt?
Colette Brillant ist eine Figur, die ich an die Romanautorin Sidonie-Gabrielle Claudine Colette anlehnte, die französische Schriftstellerin, deren „Claudine“-Werke von ihrem Ehemann schamlos unter seinem Namen veröffentlicht worden sind. Ihr Nachname ist von einem französischen Tangotanzpartner übernommen. Colette Brillant ist in dem wichtigstem Lebensprozess, den ich mir vorstellen kann: sich selbst erforschend, tröstend, motivierend mit der Lektüre von aberhunderten Büchern. Die Nebenwirkung: man wird grauenhaft unabhängig von der Meinung anderer. Das Risiko: Man verliert ein wenig die Anbindung an das ungezähmte Leben außerhalb der Bücher …
„In unserer Handschrift ist nichts unversteckbar.“
Colette versteht sich auch auf Kalligrafie. Stilfrage oder geistige Haltung?
In unserer Handschrift ist nichts unversteckbar. Ich hüte einen sehr kurzen Brief meines Vaters, und wenn ich seine Buchstaben sehe, seine Schrift, ist es, als sei seine Energie noch da, über den Tod hinaus. Ja, es ist diese Lebendigkeit, die in der Handschrift ist, das Unsterbliche, das mich rührt. Es geht die Legende, dass man jenem, dem man seinen eigenen, handschriftlichen Namen schenkt, Macht über das Herz gewährt. Erst wenn der Brief vernichtet wird, ist man wieder frei.
Müssen besondere Botschaften unbedingt stilvoll auf Büttenpapier geschrieben sein wie bei Colette? Oder geht auch ein Post-it?
Mein Mann schreibt mir zum Geburtstag oft einen Brief mit Tinte auf festem Papier. Er schenkt mir damit Zeit und sich selbst. Was gibt es Kostbareres? Ich bin übrigens direkt nach dem Interview nach Hause gerannt und habe ihm ein Post-it an den Computer geklebt. Danke also für die Inspiration!
Ob Colette, Großmutter Aimée und vor allem Marie-Jeannes Maman Elsa: Es wird viel und köstlich gekocht. Was symbolisiert die Kulinarik im Roman? Und ist es auch Ihre eigene Leidenschaft?
Für und mit jemandem zu kochen ist eine Liebestätigkeit. Und gerade in Frankreich wird Zusammenhalt durch gemeinsames Essen zelebriert. Ich habe entsprechend durch das Solo-Dinner der Notarin wiederum ihre Einsamkeit erzählt. Und sie dann allein Tango tanzt, die Luft umarmt. Allein zu Essen, allein zu tanzen – das sind die Momente, wo das Ziehen im Inneren so stark ist, das Ziehen nach jemandem, nach etwas, nach gehalten werden. Ich selbst koche gern und habe von meiner Mutter, Restaurantchefin, das Kochen nach reinem Instinkt gelernt, auf der Basis der Kenntnisse um Gewürze, Kräuter, Eigengeschmack, aber auch Kontraste und das Spielen mit Konsistenz und Farbe.
Tangomusik gehört nicht nur zum Abendritual der Notarin in „Südlichter“, sondern auch zu Ihren Leidenschaften. Was lieben Sie daran?
Tango Argentino bringt zwischen zwei Fremden etwas intimes Gemeinsames hervor. Das „Viertgefühl“. Die Seele singt. Fühlt sich in Umarmung geborgen. Tango Argentino ist Intimität ohne Gefahr, verletzt zu werden, und damit ein unerreichbares Ideal einer Beziehung. Für genau drei Lieder.
Als Grundausstattung für ein halbwegs glückliches Leben empfiehlt Monsieur Perdu etwa ein eigenes Zimmer und eine Katze. Was gehört für Sie selbst dazu?
Verstanden und trotzdem gemocht werden, ein eigenes Zimmer und ein Gesicht, das ich immer wieder anlächeln will.
Sie sind nicht nur als Autorin erfolgreich, sondern wurden in der Buchbranche in wichtige Ämter gewählt. Ihr Antrieb? Und Ihr wichtigstes Anliegen?
Mein Leben als Schriftstellerin endet nicht nach dem letzten Punkt einer Geschichte. Um Arbeitsbedingungen, Autorenrechte, um den Erhalt von unabhängiger Kultur zu kämpfen, ist für mich gleichsam ein Dienst an Demokratie und integrer Gesellschaft. Ich sehe Literatur und ihre Schöpferinnen als dringend nötige Opposition zu destruktiven politischen, wirtschaftlichen und monopolistischen Tendenzen. Wir vermitteln Werte, Diversität, Variationen von Leben, wir stellen den Gegenentwurf zum Totalitären, zum Populistischen dar. Als Präsidentin des European Writers’ Council, dem Dachverband von 38 europäischen Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverbänden, ist mein Ziel, die rechtliche und wirtschaftliche Basis der Buchbranche zu schützen, mitunter auch vor Angriffen aus der Politik, aber auch das europäische Ideal einer Gemeinschaft von Individuen. Das freie Wort muss sich dem erfolgsgierenden Markt genauso widersetzen wie konkreten Angriffen. Ohne Autorinnen und Autoren gibt es keine Kultur, keine Bücher, keinen inneren Resonanzraum. Mein Ziel: stetig gegenhalten. In der Politik gewinnt man nie, aber man hat schon verloren, wenn man andere einfach nur machen lässt.