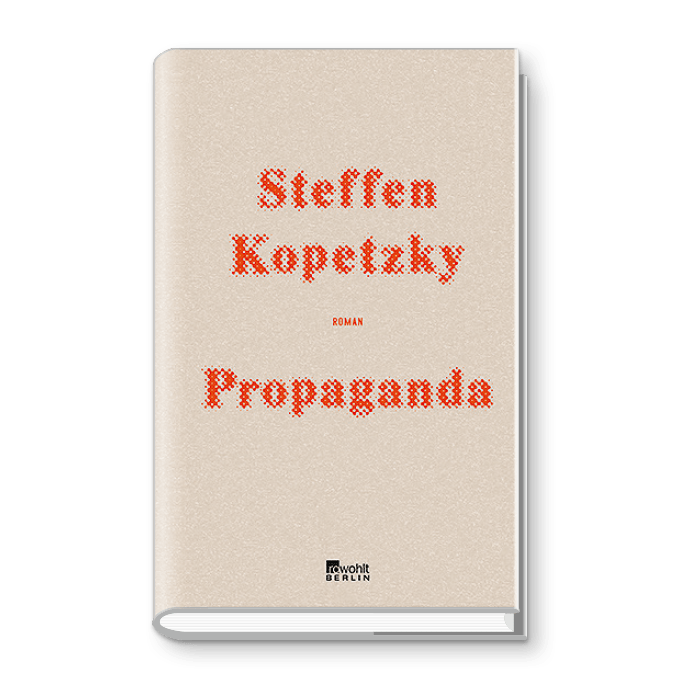Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 250 Lesepunkte sammeln
250 Lesepunkte sammeln
GEWAGT UND GEWONNEN: Steffen Kopetzky können Herausforderungen offenbar nicht groß genug sein. Seine Brillanz bewies er zuletzt mit „Risiko“, einem Abenteuerroman über die geheime Hindukusch-Expedition des deutschen Kaiserreichs. Eine noch schwindelerregendere Mission, die Weltgeschichte umzuschreiben, schildert er nun in seinem neuen Meisterwerk „Propaganda“. Der Held: John Glueck, hochdekorierter US-Offizier, der alles aufs Spiel setzt, um die Lügen seiner Regierung zu entlarven und den Vietnamkrieg zu beenden. Der erste große Leaking-Fall der US-Geschichte!
Wie lange haben Sie an Ihrem gewichtigen neuen Werk „Propaganda“ gearbeitet und welche Mengen an Büchern und Archivmaterial ausgewertet?
In den drei Jahren habe ich knapp dreihundert Bücher und Dokumente studiert. Romane, Erlebnisberichte, historische Werke. Aber die Menge allein ist nicht entscheidend. Ich musste vielmehr die entscheidenden Seiten in den richtigen Büchern finden, die es brauchte, um die literarischen Ideen, die Figuren und den Plot zu vernetzen: Das waren einerseits die grausame Allerseelenschlacht, die größte Niederlage in der Geschichte der US-Armee, auf der anderen Seite „Das Wunder vom Hürtgenwald“. Als ich das erste Mal davon hörte, wusste ich sofort: Das ist der richtige Ausgangsstoff, um über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben.
Wie würden Sie das Ziel auf den Punkt bringen, das Sie sich für „Propaganda“ gesteckt hatten?
Das einfache Ziel, das ein Autor immer haben muss: Ich wollte einen großartigen Roman schreiben, den die Leser nicht aus der Hand legen können und der die Kritiker begeistert.
Die historische Hauptlinie führt vom Zweiten Weltkrieg zum Vietnamkrieg. Warum haben Sie ausgerechnet diese Bezugspunkte gewählt?
Das hat auch mit meinem Helden und seiner Generation zu tun. Als junge Leute voller Idealismus zogen sie in den Krieg gegen die Nazis – nur um sich um sich zwanzig Jahre später als Angehörige des am meisten gehassten Landes der Welt wiederzufinden. Es gibt Romane über den Zweiten Weltkrieg und Romane über den Vietnamkrieg, aber über diese fatale Entwicklung der USA und diesen Zwiespalt innerhalb einer Generation ist noch nie geschrieben worden. Das hat mich gereizt.
Die Ungeheuerlichkeiten beider Kriege auf den Schlachtfeldern und hinter den politischen Kulissen beschreiben Sie aus der Perspektive eines gewissen John Glueck. Held oder Anti-Held?
Beides. Der „Hans im Glück“ aus dem Grimmschen Märchen verliert zwar alles, aber eben nicht seine Zuversicht.
Johns drei wichtigste Eigenschaften?
Disziplin, Klugheit und Einfallsreichtum. Das sind übrigens auch genau die Eigenschaften, die man als Schriftsteller braucht! (lacht)
„Mann muss seinen Gegner kennen.“
Ihr John Glueck ist US-Amerikaner, aber Sie legen ihm die deutsche Kultur in die Wiege. Warum haben Sie ihm die Abstammung von Pennsilfaanier-Deitschen verpasst?
Die Deutschen in Amerika waren ja sehr präsent, nicht nur in New York oder Pennsylvania, sondern auch in Texas oder in Chicago, wo es ganze Viertel gab, in denen man kein Wort Englisch hörte. Mit den Weltkriegen änderte sich das, aber die deutschstämmigen Amerikaner, die während des Zweiten Weltkriegs für Nachrichtendienste und Propaganda gearbeitet haben, waren ein wichtiges Element der amerikanischen Kriegsführung. Man muss seinen Gegner kennen! Das ist umgekehrt einer der Gründe, warum später der Vietnamkrieg so ein Desaster war. Da hat man den Gegner nie verstanden.
Für das New Yorker Bronx-Kind John ist es das größte Ferienglück, die Hasen seiner Großeltern zu füttern. Schöpfen Sie bei solchen Schilderungen aus eigenen Erinnerungen an Ihre Kindheit in der Hallertau?
Meine Mutter stammt von einem Bauernhof und ich habe da als Kleinstadtkind tolle Erlebnisse gehabt, die natürlich oft mit den Tieren zu tun hatten. Friedvoll mampfende Milchkühe im Stall, durch den die Schwalben schnitten. Ein Gänserich, größer als ich selbst, der mich einmal attackierte … Und vieles mehr. Auch heute halten wir bei uns zu Hause in Pfaffenhofen ein Paar Kaninchen, die wir alle sehr lieben. Erstaunliche Tiere mit einer unbändigen Energie und einem gleichermaßen drolligen wie rabiaten Sozialleben.
Mit wie viel Liebe zum Detail und Genauigkeit Sie am Werk sind, zeigt sich am anschaulichsten in den Rückblenden auf Johns Kindheit. Man stellt sich unwillkürlich vor, wie Sie in Antiquariaten nach deutschen Märchenbüchern und Spielkarten stöbern. Wie war’s?
Die Spielkarten, die Sie meinen, habe ich vor zehn Jahren an einem eiskalten Januartag in Berlins schönstem Zauberladen entdeckt. Damals ahnte ich noch nicht, welche Rolle das Pik-Ass daraus einmal in meinem amerikanischen Roman spielen würde.
Manche Kindheitsszenen würden einer Filmkomödie alle Ehre machen: Johns Mutter predigt Ehrlichkeit, Johns Großvater unterwandert dieses oberste Gebot lustvoll, indem er den Jungen in seine Kartenspieler-Tricksereien einweiht. Warum ist Ihnen dieser frühe Zwiespalt wichtig?
Auf der einen Seite steht die altdeutsche und fromme Tradition der Pennsilfaanier-Deitschen, die schon seit dem 16. Jahrhundert in Amerika siedelten, auf der anderen das Glücksrittertum der bettelarmen Migranten am Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Bandbreite innerhalb der Deutsch-Amerikaner zu zeigen, war mir wichtig.
„Es ist auch eine Hommage an das andere, bessere Amerika.“
Schon den Prolog kann man als Schlüsselszene deuten, wie sich Krieg auf einzelne Menschen auswirkt, die Vietnam-Eindrücke erst recht. Was war Ihr roter Faden beim Schreiben?
John Gluecks Geschichte ist die eines Mannes von 50 Jahren, der alles verloren hat, woran er seit seiner Jugend geglaubt hat. Aber dennoch findet er die Kraft, in der größten Niederlage und von Krankheit gezeichnet, zu seinen alten Idealen zurückzukehren und Widerstand zu leisten. Insofern ist der Roman eine persönliche Lebensbeichte, aber auch eine Hommage an das andere, das bessere Amerika, nach dem wir uns auch heutzutage sehnen.
Wo die Wirkung der Propaganda an Grenzen stieß, mussten andere Mittel her. Da packen Sie ein heißes Eisen an, nämlich den Einsatz pharmakologischer Substanzen …
Seit dem dreibändigen „Nazis on Speed“ weiß man ja genau über den massiven Konsum von Stimulanzien im Dritten Reich und bei der Wehrmacht Bescheid: Pervitin, das man heute als Crystal Meth kennt, war omnipräsent – genau wie Drogen während des Vietnamkrieges, jeder Dritte nahm Marihuana, viele aber auch Heroin, das mit Militärmaschinen auch im großen Stil in die USA kam. Der CIA wiederum flutete in den Siebzigern Berlin mit Heroin, um die DDR zu destabilisieren. Drogen waren also auch immer Teil der Kriegsführung und sind es bis heute. Denken Sie an Afghanistan!
John bringt es zum hochdekorierten Offizier. Welchen Eigenschaften und Fähigkeiten verdankt er seine Militärkarriere? Und was treibt ihn, sie aufs Spiel zu setzen und sich mit den Mächtigen anzulegen?
John Glueck war immer ein Spezialist, jemand, der eine Situation vollkommen durchdringen konnte. Das befähigt ihn auch zur Verschwörung gegen die Lügen des Weißen Hauses über Vietnam. Niemand hat zugegeben, wie aussichtslos der Krieg ist, obwohl eine Pentagon-Studie das schon Jahre zuvor festgestellt hatte. Es ist der Widerstand eines Veteranen und Patrioten, der mit sich und den Idealen seiner Jugend ins Reine kommen möchte. Das gibt ihm die Stärke, sich endlich zu widersetzen.
„Die Tatsachen sind erstaunlich genug, da muss man nichts erfinden.“
Nicht zuletzt ist Ihr Roman eine Gratwanderung zwischen Fakten und Fiktion. Welche Maxime diente Ihnen dabei als Kompass?
Fiktion ist es, aber nicht gegen den Sinn oder den Ablauf des historischen Geschehens. Der anspruchsvolle Bücherleser unserer Tage pflegt die Dinge penibel zu recherchieren, was ganz in meinem Sinne ist, denn ich wünsche mir ja, dass meine Leser die Zusammenhänge der Geschichte nachvollziehen können. Deshalb versuche ich, so nah an den Fakten zu bleiben wie irgend möglich. Die Tatsachen sind in der Regel erstaunlich genug, da muss man nichts erfinden.
Unter den berühmten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die in „Propaganda“ auftauchen, ist Hemingway die wohl schillerndste Gestalt – und vielleicht die tragischste …
Als ich anfing, mich mit dem Hürtgenwald zu beschäftigen, stieß ich bald auf Hemingway, der dort als Kriegskorrespondent war. Als erstes las ich natürlich seinen Roman „Über den Fluss und in die Wälder“, der aber eigenartig lau ist. Als ich dann aber verstand, in welchen Nöten Hemingway damals steckte – Dauerkopfschmerz, Midlifecrisis, eine weitere kaputte Ehe und, am schlimmsten, eine depressive Schreibblockade –, las ich seinen Roman anders. Er scheiterte daran, das Desaster und das Grauen des Hürtgenwaldes zu beschreiben – vielleicht weil dort eben eine neue Epoche in der Geschichte der USA eingeläutet wurde. Das rücksichtslose Vorgehen der Generäle, um vor den Sowjets an Rhein und Ruhr zu sein, war von einer neuen Qualität – der unwiderrufliche Schritt zur Gnadenlosigkeit einer Weltmacht.
„Nur die Wahrheit kann uns helfen …“
Wenn der ganz junge John seine ersten bewussten Wahrnehmungen von Politik in Worte fasst, assoziiert man beim Lesen fast automatisch eigene Beobachtungen und Eindrücke der Jetztzeit – die Konjunktur und das Salonfähigwerden der Fake News beispielsweise. Sind solche aktuellen Bezüge in Ihrem Sinn?
Hannah Arendt hat 1971 gesagt, dass die Lüge im ersten Moment immer besser klingt als die Wahrheit, weil sie ja sozusagen maßgeschneidert ist. Aber genau deshalb, weil sie konstruiert ist, hält sie sich nicht lange. Die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht. Als Schriftsteller stehen wir notwendigerweise auf der Seite der Wahrheit, oder, falls das zu vermessen ist, zumindest auf der Seite der nach ihr Suchenden. Das ist der Sinn unserer Arbeit, darauf kommt es an, auch wenn die Zeiten in dieser Hinsicht augenblicklich recht hart sind. Aber wir dürfen nicht aufgeben, die Komplexität der Wirklichkeit und die – manchmal – bittere Wahrheit über viele Dinge immer und immer wieder zu thematisieren. Nur die Wahrheit kann uns helfen, die Dinge, die Welt, uns selbst zu verbessern.