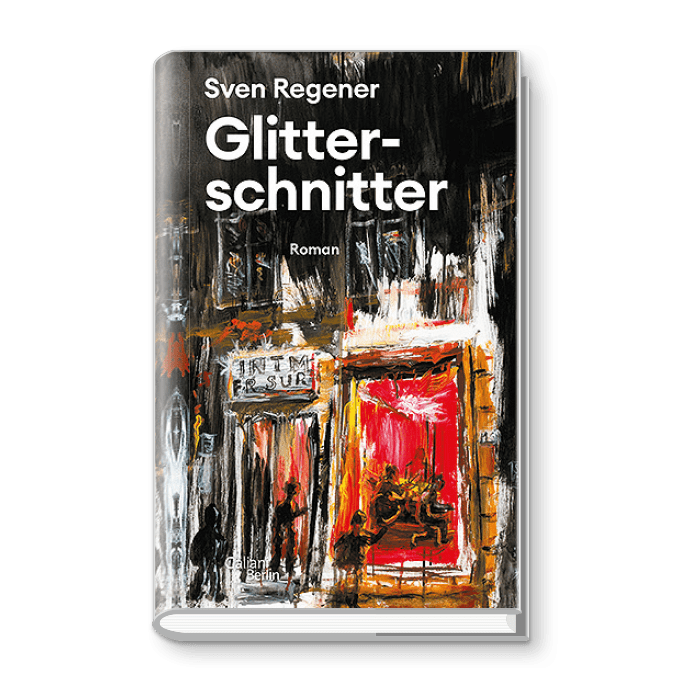Auch als eBook und Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 240 Lesepunkte sammeln
240 Lesepunkte sammeln
KULTSTATUS HAT„Herr Lehmann“ längst, genau wie sein Erfinder Sven Regener. Ein Glück für die Millionen Fans, dass der Autor genau wie sie bald nach jedem Bestseller wieder Entzugserscheinungen hat und dem Kreuzberger Kiez neue Geschichten entlockt. Dafür wurde er sogar mit der „Carl-Zuckmayer-Medaille für Verdienste um die deutsche Sprache und das künstlerische Wort“ ausgezeichnet. Österreichisch kann er ebenfalls. So geht es äußerst lustig zu in seinem aktuellen Roman „Glitterschnitter“ – mit guten Bekannten und neuen Helden.
Momentan sind Sie mit Ihrer Band „Element of Crime“ mitten in der Konzertsaison. Geht es da ähnlich abenteuerlich zu wie auf der Tournee in Ihrem Roman „Magical Mystery“?
Es geht immer um die Musik. Alles andere ist Drumherum. Abenteuer ist immer, aber bei „Element of Crime“ machen wir das schon sehr lange, da können wir uns das Schlimmste vom Leibe halten.
Eine Überraschung war für viele Ihr Ausflug in den Jazz. Was war Ihr Antrieb für den musikalischen Genrewechsel bei „Ask Me Now“?
Mit dem Jazz fing alle Popmusik, wie wir sie heute kennen, an. Und als Trompeter zieht es einen immer irgendwie da hin.
Jede Menge Lust an künstlerischen Experimenten tobt sich in Ihrem neuen Roman „Glitterschnitter“ aus. Was war das Berauschende damals, 1980, in der Ära der Kassettenrekorder und Polaroidkameras?
Es war eine Zeit nicht nur der extremen künstlerischen, sondern auch der extremen Lebensexperimente. Die spezielle Situation Westberlins begünstigte das.
„… ist, wie gute alte Freunde wiederzutreffen!“
Nach der Herr Lehmann-Trilogie, dem Sequel „Magical Mystery“ und dem Prequel „Wiener Straße“ tauchen Sie nun mit „Glitterschnitter“ zum sechsten Mal ein in die Welt von Frank Lehmann & Co. Was ist für Sie das Tolle daran
Ich mag die Figuren so sehr. Ich habe sie erfunden, ich habe sie lieb, sie sind immer für eine Überraschung gut – einen Roman mit ihnen zu bevölkern ist, wie gute alte Freunde wiederzutreffen.
Genau wie Frank Lehmann sind Sie Anfang der 1980er Jahre aus Bremen nach Berlin gekommen. Mit welchen Jobs haben Sie sich als Musikstudent über Wasser gehalten?
Ich habe als Tippse gearbeitet, erst beim Wissenschaftszentrum Berlin, dann bei der Zweiten Hand, das war eine Zeitung für kostenlose private Kleinanzeigen.
Immer wieder spekulieren Kritiker über Ihr literarisches Betriebsgeheimnis. Folgen Sie eher der Intuition oder einem großen Plan wie z.B. einst Kempowski und gegenwärtig Karl Ove Knausgard und Gerhard Henschel?
Ich folge der Intuition und dann sieht das immer doch irgendwie nach Plan aus. Sehr rätselhaft. Vielleicht eher wie bei Karl May, nur anders …
Zur Musik von „Element of Crime“ haben Sie einmal erklärt: „Die Kunst versöhnt uns mit dem Leben.“ Inwiefern trifft das auch auf Ihre Romane zu?
Die sind auch Kunst.
In „Glitterschnitter“ ist Kunst das Thema der Stunde – das jeder Ihrer Kreuzberger Aktivisten anders interpretiert. Worum geht es ihnen bei all den Ideenfunken und vermeintlichen Initialzündungen?
Um das, was diese Figuren bewegt, am Leben erhält, antreibt. Was bei ihnen dahintersteckt. Und wie sie miteinander agieren, ihre Beziehungen untereinander. Naja, kein Wunder, es ist halt ein Roman.
Ihr Roman hat etwas von einem großen Plenum. Worauf kommt es Ihnen bei den vielen Perspektiven und Stimmen an?
Dass es spannend ist, Spaß macht und die Liebe zu den Figuren gestärkt wird.
„Ein neues Zeitalter …“
Auch im „Einfall“, der Stammkneipe der Freaks, scheint ein neues Zeitalter anzubrechen. Gar eine Bedrohung des Kiez-Biotops?
Ein neues Zeitalter bricht ja irgendwie immer an. Damit muss man klarkommen. Ein Kiez-Biotop sehe ich da nicht so, dafür gibt es viel zu viel Bewegung und Einfluss von außen.
Was zeichnet für Sie eine gute Kneipe aus?
Dass man gerne möglichst lange sitzenbleibt.
Frank Lehmann versucht am „Einfall“-Tresen die Oberhand zu gewinnen. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie da aufblitzen?
Irgendwie kämpfen meine Figuren ja immer um ihr Leben, einen Platz in der Welt, sowas, das hat auch viel mit ihrem Alter zu tun, zwischen zwanzig und dreißig ist da alles offen und unsicher.
„Shakespeare“ ist zwar erst der dritte Teil im Roman betitelt, aber schon ziemlich am Anfang bahnt sich eine Art Hamlet-Frage um Sein oder Nicht-Sein an: Kneipe oder Kaffeehaus. Was braut sich da zusammen?
Da möchte ich widersprechen: Kneipe oder Kaffeehaus ist keine Frage von Sein oder Nichtsein. Shakespeare wird im Buch aber zu einer Chiffre für die Ästhetisierung des Alltags, für den Glanz, den die Kunst dem Leben verleihen kann durch Distanz und Überhöhung. Das durchzieht das Leben vieler Personen in diesem Buch.
Nicht nur im „Einfall“ sorgen P. Immels Galerie-Genossen für Staunen mit ihrem Coming-out als Österreicher. Konzeptkunst, alpiner Chauvinismus oder etwas ganz anderes?
Alles zusammen und noch viel mehr. Die Exil-Österreicher übernehmen, ich habe das beim Schreiben ja auch erst spät gemerkt, in diesem Roman immer mehr die Initiative, und mir gefällt das sehr gut.
„Die Paradeiserfratze hat P. Immel erfunden.“
P. Immel und seine „Paradeiserfratzen“ ziehen ihr Österreicher-Ding auch sprachlich durch. Wo und wie haben Sie die stilechte Wortschatzerweiterung absolviert? Vor Ort oder in einem Webinar?
Da kannte ich schon viel, an sowas kann man als Außenstehender ja viel Freude haben. Aber da ist auch die Regine Steinmetz in Wien, vor der ich damit bestehen musste. Die hat das alles kontrolliert. Die Paradeiserfratze hat P. Immel erfunden.
Berlinert wird natürlich auch. Welche Einsatzbereiche hat es und was macht es unverzichtbar?
Man berlinert ja nicht dauernd. Berlinern hat viel mit Angstbeißerei zu tun, mit einer Rückversicherung in einem eingebildeten Kollektiv, mit Abgrenzung und Unsicherheit. Eine spannende Sache.
Auf dem Prüfstand sind Baustellen und Entwürfe für Parallelwelten, z.B. das „Arsch-Art-Galerie“-Imperium von P. Immel und Ikea. Was taugen die Verheißungen und wofür?
Parallelwelten, Verheißungen, so kann man es nennen, aber eigentlich sind die doch ganz normal, wir leben doch letztendlich alle in Parallelwelten und träumen uns ein Leben zusammen.
Humor und vor allem Situationskomik haben in Ihren Romanen eine Leichtigkeit, die wie aus dem Ärmel geschüttelt wirkt. Wieviel Arbeit steckt tatsächlich dahinter?
Ich empfinde das ja nicht so sehr als Arbeit, eher als Vergnügen und Spiel. Aber das kann sich hinziehen. Für diesen Roman habe ich ein Jahr gebraucht.
Sie selbst sind fest im Kulturleben etabliert und hatten sogar schon eine Gastprofessur an der Uni Kassel. Wie war’s?
Das waren nur zwei Tage. Aber die waren sehr interessant. Ich wollte in einer Vorlesung etwas über Humor in der Literatur sagen. Das war gar nicht einfach. Solche Sachen entziehen sich ja gerne, je näher man ihnen kommt. Und dann habe ich in einem kleinen Seminar einiges von den Studenten gelernt … Das war natürlich toll, obwohl es wahrscheinlich anders gedacht gewesen ist.