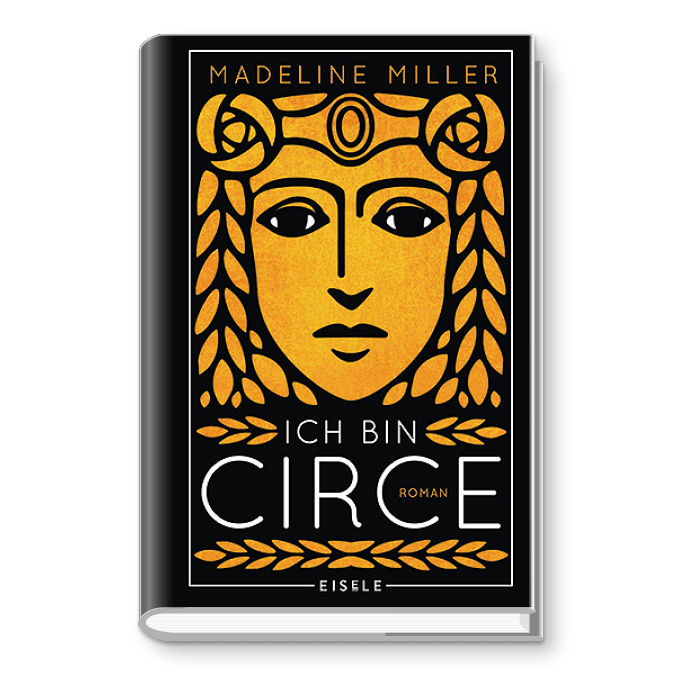Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 240 Lesepunkte sammeln
240 Lesepunkte sammeln
Lalena Hoffschildt ist von Kindesbeinen an dem Lesen verfallen – die Ausbildung zur Buchhändlerin, die sie 1995 bei Hugendubel am Marienplatz antrat, war quasi zwingend. Aktuell ist Lalena im Filialleitungsteam am Stachus tätig – und auf Instagram unter @lalenaparadiso aktiv. Die Interview-Serie #ZehnFragenAn entstand mehr oder minder durch Zufall. Heute interviewt sie für uns die Übersetzerin Frauke Brodd.
1. Kennengelernt habe ich dich – erst als @dieuebersetzerin auf Instagram und dann persönlich – durch deine Übersetzung von Carol Rifka Brunts „Sag den Wölfen, ich bin zu Hause“ aus dem Eisele Verlag, und nun ist gerade eine weitere Übersetzung von dir aus dem Amerikanischen erschienen: „Ich bin Circe“ von Madeline Miller, wieder bei Eisele.
Wie wurdest du Übersetzerin, hast du das zielstrebig studiert? Übersetzt du nur Belletristik, oder auch Sachbuch?
Ich bin eine Quereinsteigerin und wollte nie übersetzen, da ich sehr großen Respekt vor dieser Arbeit hatte – und immer noch habe! Ich habe Literatur studiert, war Lektorin in verschiedenen Verlagen, habe viele Übersetzungen vergeben, sie dann oft selbst redigiert, aber das war’s. Als ich mich dann 2007 aus privaten Gründen in Luxemburg selbstständig gemacht habe, gab es eine liebe Freundin und Ex-Kollegin, die mich immer wieder gefragt hat, ob ich nicht mal übersetzen wolle. Irgendwann habe ich zugestimmt, den ersten Vertrag unterschrieben und losgelegt. Und dann wurde mir sehr schnell klar, warum ich so große Hochachtung vor dem Übersetzen hatte: Ein Buch, das man übersetzt, offenbart unglaublich viele Informationen zwischen den Zeilen. Informationen, die recherchiert, durchdacht, verworfen oder berücksichtigt werden wollen. Für mich ist das wie eine eigene Geschichte in der Geschichte. Das geht mir in der Belletristik so, die ich hauptsächlich übersetze, aber auch im „erzählenden Sachbuch“, in Autobiographien wie der von Diane Keaton oder in dem wunderbaren Buch von Elizabeth Lesser „Zwei Schwestern, ein Leben“, das mich persönlich tief berührt und weitergebracht hat. Sachbücher im strengen Wortsinn übersetze ich nicht.
2. „Wie wichtig ist der Text, den du übersetzt? Hast du den Luxus, wählen zu können, und ist es überhaupt wichtig, ob dir die Geschichte etwas sagt, dich berührt?
Ich habe mit dem angefangen, was man mir angeboten hat: die Krimiautorin Faye Kellerman. Ich hatte aber auch keine Ansprüche oder Wünsche, denn ich war in der glücklichen Rolle, gefragt zu werden und nicht selbst herumfragen zu müssen. Es stand mir gar nicht zu, irgendetwas auszuwählen. Ob ich mittlerweile den Luxus habe, mir die Romane aussuchen zu können? Ja und nein. Natürlich müsste ich nichts übersetzen, was mir überhaupt nicht gefällt, aber wenn einfach kein anderes Angebot reinkommt, erübrigt sich die Frage, denn mit Übersetzen wird man nicht reich, und die Kosten für das Büro laufen weiter, die Miete, die Sozialversicherungen, etc. Wenn mich eine Geschichte berührt, ist es manchmal sogar schwieriger, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, da die Distanz zu den Figuren flöten geht. Und wenn es dann noch Themen sind, die mich gerade selbst beschäftigen, wie z.B. bei Lesser, dann kann das Arbeiten schon sehr unter die Haut gehen.
3. „Jedweden“, „apotropäisch“, solche Wörter liebe ich, woher schöpfst du sie … blätterst du manchmal in einem Wörterbuch und sammelst?
Nein, überhaupt nicht! Diese Ausdrücke tauchen einfach auf, manchmal werden sie auch flugs wieder von den Lektoren herausredigiert. Bei Madeline Millers „Ich bin Circe“ hatte ich das Glück, dass die Autorin selbst ein Faible für altmodische Ausdrücke hat. Ich habe sehr viel mit ihr per Mail abgeklärt, da ich sichergehen wollte, dass mein Instinkt mich nicht täuscht und sie tatsächlich Wörter z. B. aus dem Mittelenglischen hervorgekramt hat. Es war ein Erlebnis, denn ich durfte zum ersten Mal seit Langem wieder mein uraltes Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language aus dem Regal holen, entstauben, Platz dafür freischaufeln neben dem Computer und dann wie früher darin herumblättern und suchen.
4. Ein Übersetzer, eine Übersetzerin beugt sich dem Strom fremder Worte, fremder Gedanken. Wie fühlt sich das an? Das ist doch sicher etwas ganz anderes als zu lesen, du bist ja die Trägerin, die Überbringerin dieser Geschichte?
Ich habe als Lektorin hunderte Manuskripte geprüft, manchmal über Nacht, ich kann sehr schnell lesen und urteile zu 99 % aus dem Bauch heraus, ob mir ein Manuskript gefällt oder nicht. Doch in meiner Rolle als Übersetzerin lese ich und erlebe ich einen Text anders. Für mich ist Übersetzen ein sehr multi-sensueller Vorgang. Ich höre meine Figuren reden, sie haben eine bestimmte Art, sich auszudrücken, sie bewegen sich auf eine ganz eigene Art und Weise, ich sehe sie vor mir, sie sind mir sympathisch oder auch mal unsympathisch. Ich rede mit ihnen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, manchmal auch laut, und dann bin ich froh, wenn ich niemandem begegne. Es gibt, soweit ich das beurteilen kann, zwei „Schulen“ beim Übersetzen. Manchen ist das Original heilig, und man darf nichts verändern; andere sagen, dass die Übertragung ins Deutsche für deutsche Leser verständlich sein muss, und zwar auch dann, wenn sie kein Englisch beherrschen und sich nicht mit den Gepflogenheiten, Sitten, Bräuchen etc. im Ursprungsland des Textes auskennen. Vielleicht liegt es daran, dass ich vor dem Übersetzen viel redigiert habe – ich respektiere natürlich das Original, und ich schreibe es nicht um, aber manchmal traue ich mich der Verständlichkeit zuliebe einzugreifen. Ich übersetze diese Stellen, wie sie im Original stehen, merke dann aber oft als Kommentar an, dass hier ein Fehler ist oder man das einfach im Deutschen nicht versteht. Eine echte Herausforderung sind Wortspiele und Reime, da kommt Freude auf!
5. Du übersetzt auch aus dem Französischen, empfindest du einen Unterschied beim Hineinschlüpfen und Durchlassen der fremden Sprachen? Ich persönlich bilde mir bei einer guten Übersetzung ein, den Original-Tonfall der Muttersprache durchzuhören. Kann das sein?
Literatur übersetze ich nicht aus dem Französischen. Ich arbeite in Luxemburg als Texterin – mein drittes Standbein neben Übersetzen und Redigieren –, und dafür schreibe und übersetze ich kreuz und quer in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Französische Literatur ist mir immer ein bisschen fremd geblieben, auch nach sieben Jahren Wohnsitz in Frankreich. Ich hab’s immer wieder versucht, aber es ist nie die große Liebe geworden.
Ich hoffe, dass man den Original-Tonfall der Muttersprache in meinen Übersetzungen durchhört, vor allem bei Carol Rifka Brunts „Sag den Wölfen, ich bin zu Hause“ und bei Madeline Millers „Ich bin Circe“. Beide Romane waren insofern herausfordernd, dass beide Heldinnen eine sehr starke Stimme haben. June in den „Wölfen“ ist ein vierzehn-, fünfzehnjähriges Mädchen – sie ist ein bisschen altklug, aber eben noch sehr jung, und wird mit Themen konfrontiert, mit denen selbst Erwachsene nicht umgehen können. Wie denkt, spricht, fühlt sich da ein Teenager? Und woher soll ich das wissen? Ich bin vierzig Jahre älter. Aber da hilft mir meine instinktive Herangehensweise an die Figuren, denn ich habe mich mit June unterhalten und genau zugehört, wie sie mir antwortet. Im englischen Original war das Vokabular nicht sehr differenziert, aber im Deutschen stehen uns ja zum Glück unzählige wunderschöne Verben für Gefühlsregungen zur Verfügung. Da konnte ich mich ein bisschen austoben und habe sicherlich, würde man einen Puristen fragen, das Original leicht verändert.
Circe, Hexe von Aiaia, ist eine so starke Frauenfigur, dass sie allen Leserinnen ein unglaubliches Identifikationspotenzial bietet. Ich liebe sie einfach, ich möchte sie kennenlernen, ich möchte mit ihr am Kaminfeuer sitzen und quatschen, lachen, weinen. Ich habe alles gegeben, um sie so reden zu lassen, sie so zum Leben zu erwecken, dass ich der Autorin in die Augen schauen und ihr sagen kann: „Ich hoffe, sie ist auch im Deutschen so, wie du sie dir vorgestellt hast.“ Der Text ist so verdichtet, dass ich auf halber Strecke eine Art Paranoia entwickelt habe, mir könnte eine Anspielung durch die Lappen gegangen sein. Gott sei Dank konnte ich mit Madeline Miller mailen – und schließlich aufatmen, dass sich nicht hinter jedem Wort etwas Tiefsinnigeres verbirgt. Aber es war wichtig, diese Stellen und den dazugehörenden Kontext – und der reicht von Homer über Chaucer und Shakespeare bis in die Gegenwart MeToo – zu identifizieren. Ich musste das Universum der Autorin kennen, und ich glaube, dass es sich wie eine Matrix, wie ein unsichtbares Geflecht über den ganzen Text gelegt hat. Nicht einzelne Stellen wurden davon beeinflusst, sondern das große Ganze. Ich hoffe, dass die Leserinnen das spüren und vielleicht nicht einmal genau sagen können, was das Besondere an diesem Roman ist.
6. Du bist freie Übersetzerin, nicht an einen Verlag gebunden, das ist wahrscheinlich Segen und Fluch zugleich, oder? Ist es schwer für dich an gute Manuskripte heranzukommen und wie läuft das ab?
Ich bin gerne selbstständig, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Bücher, die ich übersetzt habe, sind meine Werbung, und ich kann nur darauf hoffen, dass mein Stil und meine Umsetzung vielen Lektoren gefallen und sie sich bei mir melden. Aber ich mache mir keine Illusionen: Man kann nicht jedem gefallen, und es gibt bestimmt auch kritische Stimmen zu meiner Herangehensweise an Texte.
7. Du lebst in Luxemburg, das scheint mir eine perfekte Umgebung für einen mehrsprachigen Menschen. Wie bist du aufgewachsen, auch mehrsprachig? Ich frage mich, woher kommt deine Affinität zu Sprachen?
Ich bin außerhalb von München aufgewachsen, und Bücher waren, seit ich denken kann, meine besten Freunde. Auf dem Dorf gab es eine Bücherei, und ich habe erst die Kinder-, dann die Jugend- und irgendwann die Erwachsenenliteratur verschlungen. „Rebecca“ von Daphne du Maurier ist mir in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit, nicht gerade eine geeignete Lektüre für eine Zehnjährige.
Vielleicht liegt es an dem vielen Lesen, dass ich Sprache so mag. In der Schule habe ich Englisch gehasst, Französisch geliebt, aber dann nach dem Abitur fast 20 Jahre lang kaum gesprochen. Dann kam Englisch wieder in mein Leben über das Studium. Es gibt da keine logische Entwicklung, es war alles eher Zufall. Und in meiner Familie bin ich die Einzige mit dem Sprachfimmel.
8. Was ist dein bevorzugter Arbeitsplatz und hast du so etwas wie eine Routine, zum Beispiel ein „Seitenpensum“?
Ja, ich rechne mir auf die Seite und den Tag genau aus, wie ich einen Roman in dem mir zur Verfügung stehenden Zeitraum zu Ende bringen kann. Ich übersetze eher langsam, am liebsten fange ich früh am Morgen an. Und ich habe von Anfang an in Luxemburg immer ein Büro gemietet, zuerst allein, aber seit vielen Jahren schon als Co-working Space, da Übersetzen eine einsame Angelegenheit ist. Ich finde es schön, nicht allein irgendwo zu sitzen. Meine Mietmieter stören mich überhaupt nicht bei der Arbeit, allerdings kann ich, sobald Musik läuft, keinen geraden Satz mehr schreiben. Da bin ich komplett blockiert. Das war aber schon früher so – ich konnte nie mit Musik lernen.
9. Ein Frage die auch Buchhändler oft gestellt bekommen, vielleicht eine lästige Frage: Warum schreibst du nicht selbst?
Ach ja, das fragen mich viele meiner Freunde, und ich habe auch ein paar Ordner im Computer mit Ideen und Anfängen und Spannungsbögen und und und. Aber ich bin zu kritisch: Sobald ich ein paar Seiten geschrieben habe, fange ich an, sie zu redigieren. Tja, so wird das nie etwas.
10. Die zehnte Frage heißt wie immer: Stell dir vor, du hast drei Wünsche frei, welche wären das?
Ich hab’s nicht so mit dem Wünschen. Ich lebe jetzt, gestern ist vorbei, und morgen gibt’s noch nicht. Wünsche passen da nicht so ins Konzept. Ich hoffe aber natürlich jeden Tag aufs Neue darauf, dass die Menschen respektvoller und leiser miteinander umgehen. Im Kleinen wie im Großen. Da muss ich immer bei mir selbst anfangen, und das hat nichts mit Wünschen zu tun, sondern mit Machen: Frauke, mach’s einfach. Und zwar heute.