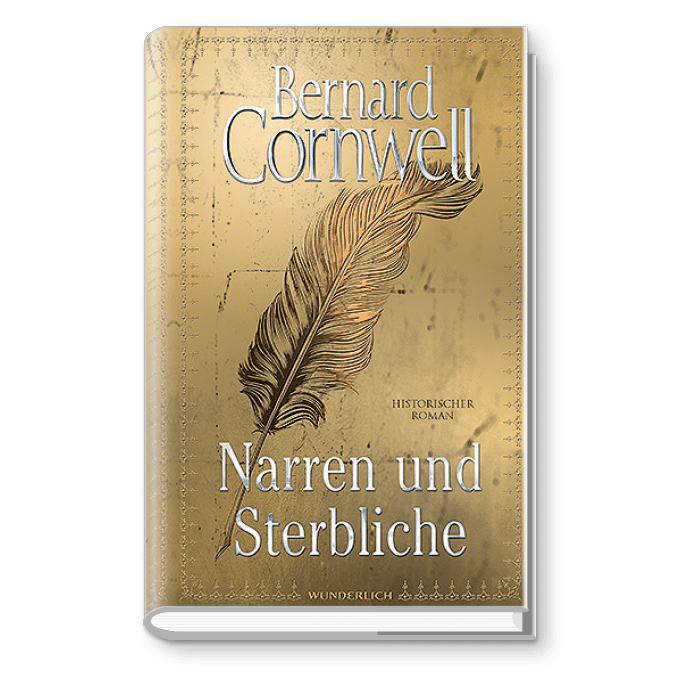Auch als eBook
auf Hugendubel.de erhältlich
 250 Lesepunkte sammeln
250 Lesepunkte sammeln
KLAR, BEI BERNARD CORNWELL denken die meisten Leser zuallererst an klingende Schwerter und Schlachten, an Welterfolge wie seine Artus-Chroniken oder den Uhtred-Zyklus. Nun präsentiert sich der 1944 in London geborene und seit 1980 in den USA beheimatete Autor von einer kaum bekannten Seite: als großer Theaterkenner und -liebhaber. In seinem neuen Roman lässt er Englands Goldenes Zeitalter lebendig werden. Eine glanzvolle Premiere für den Großmeister des historischen Romans!
Sie leben seit 1980 in den USA, aber Ihr Herz schlägt anscheinend nach wie vor für die englische Geschichte. Was macht sie so unerschöpflich und faszinierend für Sie, dass Sie viele Ihrer Romane in England ansiedeln?
Ich kenne einfach die britische Geschichte am besten. Mit britischer Geschichte bin ich aufgewachsen, in der Schule habe ich sie regelrecht aufgesogen – ich liebte den Geschichtsunterricht. Und wie Sie sagen, die britische Historie ist unerschöpflich. Ich höre englische Stimmen in meinem Kopf, weiß, wie meine früheren Landsleute denken … So habe ich eigentlich keine andere Wahl, oder? Ich behaupte nicht etwa: „British is best“, was auch nicht stimmen würde. Ich fühle mich einfach in englischen Kulissen am wohlsten!
Überkommt Sie manchmal auch einfach Heimweh? Sind Ihnen die Recherchen somit auch willkommene Anlässe für Reisen in Ihre frühere Heimat?
Entschieden nein. Auf YouTube kann ich Cricket schauen, die Amerikaner lernen allmählich, Bier zu brauen, das schmeckt. Vor allem liebe ich die beiden Orte, in denen wir leben: im Sommer in einem Küstenort auf Cape Cod, im Winter in Charleston, South Carolina. Meine Ehefrau Judy und ich besuchen England mindestens zweimal im Jahr. Aber wir leben jetzt seit fast vierzig Jahren in den USA – und Amerika vermittelt uns inzwischen das Gefühl von Heimat.
George R.R. Martin rühmt Sie als besten Schlachtenszenen-Schilderer aller Zeiten. Wie treffend finden Sie dieses Lob?
Wie könnte ich George widersprechen? Natürlich bin ich ihm für sein Kompliment dankbar. Und ja, wahrscheinlich sind mein Spezialgebiet historische Romane, in denen das Militärische eine große Rolle spielt. Aber meine Theatererfahrungen während der letzten zehn Jahre erweckten in mir ein brennendes Verlangen, über die Geburt des Theaters zu schreiben. Als ich über „Narren und Sterbliche“ sagte, dass darin niemand stirbt und dass Feen darin vorkommen, hat man mich sehr eigenartig angeschaut.
Ihren neuen Roman „Narren und Sterbliche“ widmen Sie dem „Monomoy Theatre“ und zwar dem gesamten Ensemble einschließlich Technikern. Was begeistert Sie so?
Das „Monomoy-Theatre“ bringt jedes Jahr an die 40 Studierende des dramatischen Fachs und Schauspiel-Eleven zusammen. Sie führen in zehn Sommerwochen zwei Musicals und sechs Theaterstücke auf. Die Regie und die Hauptrollen übernehmen Profis aus New York oder London. Irgendwie bin ich da hineingeraten. Ich arbeite gern mit diesen jungen Leuten. Die meisten von ihnen sind um die 21 oder 22, ich bin 74. Was zählt, ist vor allem die Begeisterung und das freundschaftliche Miteinander im Team. Als ich vor 10 Jahren anfing, hatte ich keinerlei Bühnenerfahrung. 2017 spielte ich den Prospero in Shakespeares „Sturm“ – ich muss also etwas richtig gemacht haben!
„Ein Drahtseilakt, der jeden Augenblick schiefgehen kann.“
Raten wir richtig und Sie sind auch ein begeisterter Theatergänger? Was lieben Sie besonders?
Richtig geraten! Wofür wir das Theater lieben? An sich schon ein Ereignis ist der Live-Charakter – das Wissen, dass die Schauspieler einen Drahtseilakt aufführen, der jeden Augenblick schiefgehen kann. Das gibt dem Theater eine Spannung, an die das Fernsehen und der Film nicht herankommen. Wir schauen uns so viele Aufführungen wie möglich an …
In „Narren und Sterbliche“ tauchen Sie ein in das Zeitalter von Königin Elizabeth I. Was inspirierte und interessierte Sie am meisten an dieser Ära?
Nicht Elizabeth, so interessant sie auch ist. Ausschlaggebend war Shakespeare.
Was sprach dafür, Ihre Romanhandlung ausgerechnet 1595 beginnen zu lassen?
Shakespeare etabliert sich so richtig. 1595 verfasst er zwei Meisterwerke: „Ein Sommernachtstraum“ und „Romeo und Julia“. Der Hintergrund meines Romans ist die außergewöhnliche Geschichte, wie sich das professionelle Theater in London herausbildete. Ich gebe zu, meine Entscheidung für 1595 war stark vom „Sommernachtstraum“ beeinflusst. Ich bin in zwei Inszenierungen aufgetreten. Und das ersparte mir eine Menge Recherchen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich faul bin?
Auch ihre prächtigen Gewänder können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Elizabeth I. im Jahr 1595 nicht mehr die Jüngste ist. Und unumstritten ist sie auch nicht, oder? Die Bredouille der Königin?
Man kann schon sagen, dass sie bis 1595 unumstritten war. Verschiedenen europäischen Versuchen, sie durch einen katholischen Monarchen zu ersetzen, war die Luft ausgegangen … Aber da war eine drängende Frage, die sich jedermann stellte und die niemand laut auszusprechen wagte: Wer würde Elizabeth I. auf dem Thron folgen? Ich glaube, den meisten vernünftigen Leuten war klar, dass es Jakob von Schottland sein würde – und so kam es dann ja auch. Aber Shakespeare und seine Schauspieltruppe? Wahrscheinlich war es ihnen wahrscheinlich völlig egal. Theaterleute sind Monomanen. Alles, was zählt, sind die Bühne, die Schauspieler und der Klatsch.
Trotz aller Anerkennung seines Werkes als Weltliteratur: Über das Phänomen Shakespeare wird nach wie vor spekuliert. Manche fragen sich, ob er eher Männern oder Frauen zugetan war, andere zweifeln sogar an seiner historischen Existenz. Und Sie?
Für mich steht fest, dass Will Shakespeare, Sohn eines Handschuhmachers aus Stratford on Avon, der größte Theaterdichter seines und überhaupt jedes Zeitalters ist. Mir ist egal, was seine sexuellen Vorlieben waren – ich hoffe nur, er hatte Spaß daran. Shakespeare anzuzweifeln, heißt doch, willentlich die enorme Menge von Beweisen zu leugnen, die seine Existenz und sein Genie bestätigen.
„Shakespeare weiß alles.“
Was macht Shakespeare für Sie unsterblich?
In drei Worten? Nun: Shakespeare weiß alles. Es reicht ja nicht, unsterbliche Verse zu schreiben. Er hatte auch ein außergewöhnlich tiefes Verständnis der menschlichen Seele. Aber ihn verstehen? Ihn erklären? Das kann man nicht – so wenig, wie man in die Seele von Genies wie Bach, Beethoven oder Goethe blicken kann.
Ihr Romantitel lädt zu unterschiedlichsten Interpretationen ein. Was ging Ihnen selbst durch den Kopf bei „Narren und Sterbliche“?
Nicht viel! Einen der berühmtesten Verse im „Sommernachtstraum“ spricht Puck, als er zum Elfenkönig Oberon sagt: „Gott, was für Narren sind doch diese Sterblichen.“ Und stimmt das etwa nicht?
Sie rücken nicht den großen William Shakespeare selbst in den Mittelpunkt. Stattdessen erzählen Sie aus der Perspektive seines in seinem Schatten stehenden Bruders Richard. Warum?
Weil es der Höhepunkt der Vermessenheit wäre, für Will Shakespeare Dialog zu verfassen. So geschickt bin ich nicht. Deshalb ist Shakespeare zwar da, aber wie Sie sagen, nicht im Mittelpunkt der Geschichte – allerdings dicht daran! Ich glaube, wenn man über sehr bekannte Menschen schreibt, ist es in der Regel besser, sie so zu beschreiben, wie andere sie sahen.
Richard ist alles andere als glücklich mit den Bühnenrollen, die er abbekommt. Blanke Bosheit seines Bruders William?
Richard – den es zwar gab, der aber wahrscheinlich kein Schauspieler war – sitzt in einer Falle. Er wird allmählich zu alt für die weiblichen Rollen, die von Jünglingen und jungen Männern gespielt wurden, und die Truppe seines Bruders hat bereits genügend erwachsene Schauspieler – und keinen weiteren Bedarf. Ich erfinde eine feindselige Beziehung zwischen den beiden Brüdern, aber das ist reine Fantasie.
„Es muss eine überirdische Anmutung gewesen sein …“
Sie haben sich mit der Alchemie der Schönheit und kosmetischen Tricks ebenso ausgiebig befasst wie mit Gewandung, ob bei Hof oder beim einfachen Volk wie den Theaterleuten. Was fanden Sie besonders interessant oder überraschend?
Die wahrscheinlich verblüffendste Entdeckung für mich war, dass man Perlen zerrieb, um einen Puder daraus herzustellen. Der wurde mit einer Paste vermischt, die die Knabenschauspieler auftrugen, um ihre Gesichter der Mode entsprechend weiß zu schminken und ihnen einen Schimmer zu verleihen. Das ist doch wunderbar! Natürlich konnte man das nicht für Aufführungen bei Tageslicht verwenden, aber bei Nacht! Im königlichen Palast? Es muss eine überirdische Anmutung gewesen sein!
Ziemlich entrückt …
Genau. Im Alltag war man damit beschäftigt, sich vor der Pest, vor Krankheit und plötzlichem Tod zu fürchten – letzterer war übrigens häufig. Und ansonsten dürften die langen Winterabende ziemlich von Langeweile beherrscht gewesen sein, wenn man es sich nicht leisten konnte, ins nächste Wirtshaus zu gehen …
In einer bitterkalten Nacht führt Richard ein Kamingespräch mit Pater Laurence – über Gut und Böse. Eine Schlüsselstelle?
Pater Laurence habe ich natürlich aus „Romeo und Julia“ entliehen, wo er der Klosterbruder ist. Und ja, seine Stimme ist freundlich, vernünftig und verständnisvoll. Er erweitert unseren Blick: Seine Außensicht auf Will Shakespeare ist die unvoreingenommenste und zuvorkommendste im ganzen Buch.
Worin sehen Sie für Richard insgesamt die größte Herausforderung?
Richards größte Bewährungsprobe ist es, erwachsen zu werden. Und ja, wir alle stehen irgendwann in unserem Leben vor dieser Herausforderung. Ich ziehe nicht bewusst Parallelen zur Gegenwart. Entweder der Leser sieht sie oder er sieht sie nicht. Im Übrigen wird die Gegenwart von Narren dominiert – siehe Brexit und Trump. Kein Schriftsteller würde es wagen, einen derartigen Irrsinn zu erfinden.