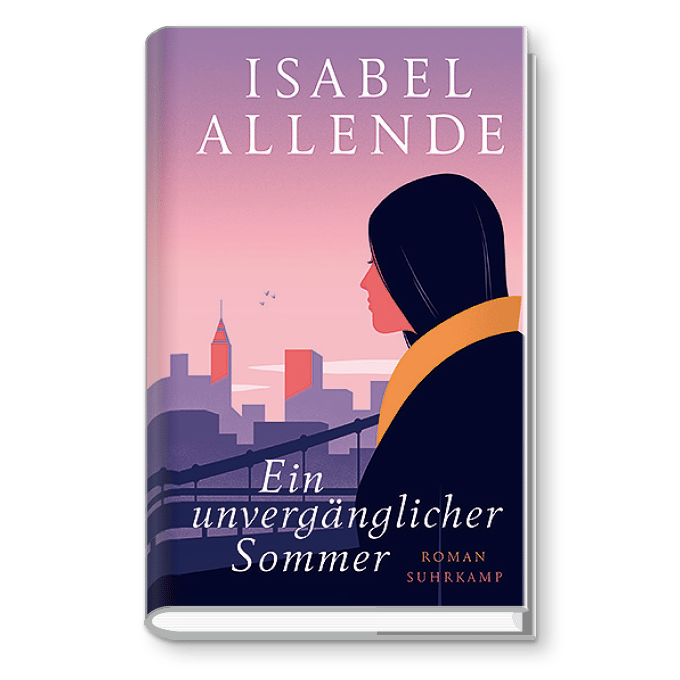Auch als Hörbuch:
Sprecher: Barbara Auer
9 CDs, Spieldauer: 622 Min.
Der HörVerlag, UVP 22,- €
Auch als eBook
auf Hugendubel.de erhältlich
 240 Lesepunkte sammeln
240 Lesepunkte sammeln
ZUM WELTSTAR der lateinamerikanischen Literatur wurde Isabel Allende 1982 durch ihr Sensationsdebüt „Das Geisterhaus“. Das Erfolgsgeheimnis ihrer insgesamt mehr als 50 Millionen verkauften Bücher: „Schreiben als Weg, der direkt in die Seele führt.“ Erzählkunst, große Gefühle, Gerechtigkeitssinn, Kampfgeist und den festen Glauben an Veränderungen zum Guten vereint. Ihr aktueller Roman – einer ihrer persönlichsten und besten – ist eine wunderbare Liebeserklärung: an das Leben und an den Glücksbringer, dem sie „Ein unvergänglicher Sommer“ widmet.
Die Zeitung „El Mundo“ schrieb: „Isabel Allende ist die Königin der Gefühle.“ Welche Gefühle prägen Ihren neuen Roman?
Einsamkeit, Ängste, Freundschaft, Liebe.
Warum „mussten“ Sie „Ein unvergänglicher Sommer“ schreiben? Welche innere Notwendigkeit gab es?
Ich hatte mich nach 28 Ehejahren von meinem Mann scheiden lassen und merkte, dass ich in einem gefühlsmäßigen Winter lebte. Mir half ein Zitat von Albert Camus: „Mitten im Winter erfuhr ich endlich, dass in mir ein unvergänglicher Sommer ist“. Es erinnerte mich daran, dass ich schon andere lange Winter überstanden hatte – und dass ich immer wieder in den Sommer zurückfand. Ich wollte die Geschichte dreier Menschen erzählen, die in ihrem ganz eigenen Winter festsitzen. Erst als sie einander ihre Herzen öffnen und Risiken eingehen, finden sie Freundschaft, Humor, Liebe und ja, Sommer.
Ihr Roman beginnt als ein Versteckspiel voller Missverständnisse zwischen zwei Menschen, die einander viel mehr bedeuten, als sie sich einzugestehen wagen. Was macht es so kompliziert?
Lucía und Richard sind nicht mehr jung. Richard hat beschlossen, sich nie wieder zu verlieben, und Lucia hat gerade eine Scheidung hinter sich. Beide sind komplizierte Menschen. Kein Wunder also, dass auch das Verhältnis zwischen ihnen kompliziert ist.
Am Anfang Ihres Romans bereitet Lucía aus Chile im bitterkalten New York „Totenerweckungssuppe“ zu. Was hat es mit diesem abenteuerlichen Gericht auf sich?
Es ist Winter, sie ist allein, sie sucht Wärme. Also bereitet sie eine kräftige Bauernsuppe zu, die sie trösten wird. Das ist es, was ich in ihrem Fall auch tun würde. Ich selbst bin keine gute Köchin, aber ich weiß um den Wert des Essens im Leben und in der Literatur.
Wie Lucía und Evelyn haben auch Sie selbst Ihre Heimat in schweren Zeiten verlassen. Als Sie 1975 von Chile nach Venezuela exilieren mussten, konnten Sie nur wenig mitnehmen. Was war und ist Ihnen das Wichtigste?
Das Wichtigste damals und heute ist für mich meine Familie. Wenn ich nahe bei ihnen sein kann, komme ich selbst in schwierigen Umständen zurecht. Als politischer Flüchtling und als Immigrantin habe ich gelernt, dass ich sehr wenig brauche. Ich kann für mich und meine Kinder sorgen. Ich bin stärker, als ich dachte. In einer Notsituation bitte ich eben um Hilfe.
Lucía, Evelyn und Richard tragen ganz unterschiedliche Erinnerungen mit sich herum, die eine gewisse Eigendynamik zu entwickeln scheinen. Welche Auswirkungen hat das?
Die drei Figuren im Roman sind durch unterschiedliche Ereignisse traumatisiert worden, die ihr Leben und ihre Erinnerungen bestimmt haben. Sie müssen die Lähmung durch das Trauma überwinden und sich dem Leben wieder öffnen. Als sie zusammen zu einem verrückten Abenteuer aufbrechen, treten sie aus ihren schlimmen Erinnerungen heraus und umarmen die Gegenwart.
„Tatkräftig, lebensklug und großzügig“
In Evelyns Erinnerung spielt ihre Mamita, also ihre Großmutter, eine Hauptrolle. Eine typische Isabel-Allende-Heldin, oder? Was lieben Sie an Concepción Montoya besonders?
Mich ziehen Menschen an, die trotz schlechter Chancen kämpfen, die schreckliche Situationen überleben und die nicht nur Erfolg haben, sondern auch anderen helfen. Concepción denkt nie daran, was sie durchgemacht hat. Sie ist äußerst tatkräftig, lebensklug und großzügig. Sie hat Erfolg, weil sie sich auf ihre Hauptrolle in dieser Welt konzentriert: ihre Enkel zu beschützen.
Wie typisch ist die Tragödie von Evelyns Bruder Gregorio für Jungen und junge Männer in Südamerika? Wie kommt es, dass Jungen wie Gregorio ihre einzige Zukunftschance in kriminellen Extremen wie der Mara Salvatrucha – kurz: M-13 – sehen?
Wir haben eine Einwanderungskrise in den USA – wegen der Gewalt der Gangs, der Drogenhändler, des korrupten Militärs und der korrupten Polizei in Zentralamerika, hauptsächlich in Guatemala, Honduras und El Salvador. Vergessen wir auch nicht die Intervention der USA in diesen Ländern, die einen Krieg gegen die Armen und die indigenen Völker unterstützten. Menschen flüchten, um wenigstens ihr Leben zu retten – wie Evelyn in meinem Buch.
Was müsste sich ändern?
Internationale Bemühungen sollten sich auf die Lage in diesen Ländern richten, um die extreme Gewalt zu verringern und schließlich zu beenden und Stabilität zu schaffen. Dann hätten Jungen wie die Ortega-Kids bessere Überlebenschancen und Mädchen wie Evelyn müssten nicht zu Flüchtlingen werden.
Evelyn verlässt ihr Heimatdorf in Guatemala schweren Herzens. Doch ihre Hoffnung auf ein besseres Leben in den USA zerschlägt sich. Ist ihr Schicksal typisch?
Leider ja, wenn man aus Zentralamerika kommt. Normalerweise haben Einwanderer Erfolg und leisten ihren Beitrag zur Gesellschaft der USA – aber dazu haben Farbige ohne Papiere gar nicht erst die Möglichkeit.
„Es gibt Hoffnung.“
Bestimmt hatten Sie Mädchen und Frauen wie Evelyn im Blick, als sie die „Isabel Allende Foundation“ ins Leben riefen. Welche Hoffnungen und Ziele verbinden Sie damit?
Ich möchte einfach so viel Hilfe leisten, wie ich nur kann. Meine Stiftung will Frauen vor allem in grundlegenden Bereichen fördern: Sehr wichtig ist uns das „reproduktive Recht“, also die eigenständige Entscheidung über Schwangerschaften, denn wer nicht über seinen Körper bestimmt, bestimmt über gar nichts. Und dann Bildung als Mittel, der Armut zu entkommen und ihre Familie zu ernähren, und Schutz gegen Ausbeutung und Diskriminierung. Jetzt haben wir ein weiteres Problem, das wir anpacken müssen: die Einwanderung.
Man kann sagen, dass Sie das Schlusswort Albert Camus überlassen. Was macht Ihnen dieses Zitat so wichtig?
Camus’ Worte erinnern mich an die schwierigen Zeiten, die ich in meinem Leben durchgemacht habe: Nichts ist von Dauer, die Dinge ändern sich, mitten in Unsicherheit und Dunkelheit gibt es Hoffnung. Ich glaube, Camus’ Zitat ist heute von besonderer Bedeutung – in einer Zeit, in der wir, wie es aussieht, in einem langen politischen und humanitären Winter leben.