

Eine journalistische Instanz ist Matthias Naß schon lange. Seit 40 Jahren bei der „Zeit“, hat er sich das Vertrauen und die Wertschätzung einer großen Leserschaft erschrieben, erst als politischer Redakteur, seit 2011 als „Internationaler Korrespondent“ und zugleich als Sachbuchautor mit sagenhaften Kenntnissen. Sein Erfahrungshorizont: Asien und der Pazifik. Wie hier gerade die weltpolitische Zukunft entschieden wird, zeigt er in seinem aktuellen Buch „Kollision“.
Spätestens als Sinologiestudent haben Sie begonnen, sich intensiv mit China zu beschäftigen – also vor rund 50 Jahren. Wie hat sich Ihr Bild entwickelt?
China hat sich in diesen 50 Jahren vollkommen verändert. Es war Anfang der siebziger Jahre ein bitterarmes, weithin abgeschottetes Land. Heute ist es die zweitmächtigste Nation der Welt, eine wirtschaftliche, politische und auch militärische Herausforderung für den Westen. An meiner Faszination für dieses Land hat sich nichts geändert. Aber es gab in diesem halben Jahrhundert immer wieder Phasen der Ernüchterung. In den vergangenen zehn Jahren ist mein Blick kritischer geworden. Unter Xi Jinping ist die Repression im Inneren stärker geworden und die Außenpolitik aggressiver.
Inzwischen bringen Sie es als Journalist auf 40 Jahre Erfahrung in Asien und im Pazifik. Was ist für Sie das Fesselnde und Faszinierende an dieser Region?
Ihr Zukunftsoptimismus. Es ist nicht alles so fertig wie in Europa. Viele asiatische Länder sind immer noch relativ arm. Aber sie wollen den Aufstieg schaffen. Dafür arbeiten die Menschen sehr hart.
„Die machtpolitische Rivalität hat sich weiter verschärft.“
Schon die Titel Ihres letzten und Ihres neuen Buches signalisieren eine Veränderung: vom „Drachentanz“ zur „Kollision“. Worin besteht für Sie die Zuspitzung des Konflikts?
Die machtpolitische Rivalität zwischen China und den USA hat sich weiter verschärft. Beide Länder – und viele andere in der Region – rüsten gewaltig auf. Die Gefahr, dass es wegen Taiwan zu einer militärischen Konfrontation kommen kann, ist größer geworden.
Immer öfter ist die Rede von einem neuen Kalten Krieg oder sogar einem drohenden „Weltenbrand“. Wie ist die Welt in diese dramatische Lage geschlittert?
Für die Vereinigten Staaten ist es selbstverständlich, die führende Nation der Welt zu sein. Und das wollen sie auch bleiben. China macht den USA diesen Rang streitig. Es ist auf dem Weg, eine ebenbürtige Weltmacht zu werden, was die Sowjetunion allenfalls militärisch war. In Washington ist es heute politischer Konsens, dass Amerika den „strategischen Wettbewerb“ mit China gewinnen muss.
„Es sind die Interessen vieler Mächte berührt.“
Als Krisenzentrum beleuchten Sie den Indopazifik. Wie stecken Sie diese Region ab, und warum eskaliert der Konflikt gerade dort?
Mit dem „Indopazifik“ sind der Indische und der Pazifische Ozean gemeint – also das Gebiet von der Westküste Amerikas bis zur Ostküste Afrikas. Im Kern geht es um die Region zwischen dem US-Bundesstaat Hawaii und Indien. Dort stoßen nicht nur die Interessen der USA und Chinas aufeinander. Es gibt auch regionale Konflikte, etwa zwischen China und Indien, ungelöste Territorialstreitigkeiten, wie im Südchinesischen Meer. Es sind die Interessen vieler Mächte berührt. Es geht nicht allein um China und die USA, sondern auch um Japan, Russland, Australien oder Indien. Selbst die Europäer zeigen im Indopazifik immer häufiger Flagge.
Wie würden Sie Ihr Buchthema auf den Punkt bringen?
Im Indopazifik kollidieren die Interessen der beiden dominierenden Mächte des 21. Jahrhunderts, Chinas und der Vereinigten Staaten, miteinander. Hier entscheidet sich, in welcher Ordnung wir künftig leben werden.
Wir hören immer öfter von einer „systemischen Rivalität“. Wer oder was prallt da hauptsächlich aufeinander?
Es prallen unterschiedliche Vorstellungen von der internationalen Ordnung aufeinander. Gibt es, wie der Westen meint, universelle Werte, die von der Staatengemeinschaft verteidigt werden müssen? Oder hat jede Regierung das Recht, in ihrem Land zu herrschen, wie sie will? Hat also die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten Vorrang? Der Konflikt zwischen dem Westen ist nicht nur ein machtpolitischer. Es geht auch um einen Systemstreit zwischen Demokratie und Autokratie.
„Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind.“
Welche Bedeutung hat im großen Kräftemessen zwischen den USA und China eigentlich Europa?
Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wirtschaftlich ist die Europäische Union eine Weltmacht. Politisch ist sie es nicht, da sie es selten schafft, mit einer Stimme zu sprechen. China versucht seit langem, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Bisher aber ohne großen Erfolg. Deutschland wird in Peking als wichtigstes Land in Europa wahrgenommen. Entscheidend ist die enge Abstimmung mit den Partnern in der EU. Europa kann in Peking nur etwas erreichen, wenn es mit einer Stimme spricht.
Nach chinesischer Auffassung ist der Westen dem Untergang geweiht. Worauf bezieht sich diese Prognose und welche Kritik sollte man sich tatsächlich zu Herzen nehmen?
Das ist Regierungspropaganda. Das gewaltige Wirtschaftswachstum der vergangenen vierzig Jahre hat Chinas Selbstbewusstsein gestärkt und einen neuen Nationalismus keimen lassen. Die Schwächen des Westens, vor allem des amerikanischen Systems, werden natürlich gesehen: politische Polarisierung, Populismus, Rassismus und Gewalt. Zugleich bleibt die Anziehungskraft des Westens groß. Es ist kein Zufall, dass Xi Jinpings Tochter in Harvard studiert hat.
In China scheint Macht vor allem einen Namen zu haben: Xi Jinping. Wie schätzen Sie ihn ein und welche Hauptziele verfolgt er für sich und sein Land?
Unter Xi Jinping ist China von einer Ein-Parteien-Herrschaft zu einer Ein-Mann-Herrschaft geworden. Er hat die Verfassung ändern lassen, um länger im Amt bleiben zu können. Seit Mao Zedong war kein Parteichef so mächtig wie Xi. Obwohl seine Familie in der Kulturrevolution sehr gelitten hat, ist Xi ein überzeugter Marxist. Sein „chinesische Traum“ ist der Wiederaufstieg Chinas zu alter Größe. Eines seiner wichtigsten Ziele ist die Vereinigung der Volksrepublik Chinas mit Taiwan, notfalls mit militärischer Gewalt.
„Kommunistisch ist China heute nur noch dem Namen nach.“
2021 hat Chinas kommunistische Partei ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Wo verorten Sie China heute zwischen Kommunismus und Kapitalismus?
Kommunistisch ist China heute nur noch dem Namen nach. In China herrscht ein Staatskapitalismus, in dem die wichtigsten Innovationen allerdings aus den privaten Unternehmen kommen. Sie schaffen auch die meisten Jobs. Aber politisch gibt immer noch die Partei den Ton an, bis in die Firmen hinein, in denen Parteizellen oft das letzte Wort haben. Unternehmer, die sich mit der KP anlegen, werden rasch kaltgestellt.
China geht es ja keineswegs nur um militärische Schlagkraft, sondern auch um wirtschaftliche Dominanz. Worin sehen Sie die größte Herausforderung?
Westliche Volkswirtschaften, allen voran Deutschland, haben sich viel zu abhängig von China gemacht. Allen Beteuerungen zum Trotz hat die deutsche Wirtschaft bisher keine Konsequenzen aus den Erfahrungen mit Russlands Angriff auf die Ukraine gezogen. Sie investiert in China so viel wie nie zuvor. Und macht sich damit erpressbar. Das gilt besonders für die Automobilindustrie. Aber auch bei den Importen von seltenen Erden und manchen Medikamenten müssen wir unsere Abhängigkeit von China verringern.
„Viele Regierungen verschulden sich bei China bis über beide Ohren.“
Zu den ambitioniertesten Projekten Chinas zählt die „Neue Seidenstraße“, international bekannt als „Belt and Road Initiative“ (BRI), die ein Investitionsvolumen von einer Billion haben soll. Was ist BRI und welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus international und speziell bei uns in Deutschland?
Die „Neue Seidenstraße“ soll helfen, Infrastrukturprojekte in ärmeren Ländern zu finanzieren. Es geht um den Bau von Straßen, Eisenbahnlinien, Brücken, Kraftwerken, Hafenanlagen. Im Prinzip alles sinnvoll. Das Problem ist: Viele Regierungen können sich diese Projekte nicht leisten und verschulden sich bei China bis über beide Ohren. Ein weiteres Problem: Bei den Bauvorhaben werden die üblichen sozialen und ökologischen Standards oft nicht eingehalten. Das Gute an BRI: Es hat die EU, Japan und die USA aufgeweckt. Die westlichen Länder stecken jetzt ebenfalls mehr Geld in den Bau von Infrastrukturvorhaben, die in den ärmeren Ländern dringend gebraucht werden.
Der Westen sortiert seine Beziehungen zu China neu. Was erscheint Ihnen dabei am wichtigsten?
Die Einheit des Westens. Europäer und Amerikaner sollten sich eng abstimmen – untereinander und mit den Demokratien Asiens und des Pazifiks, also mit Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht: Ein „De-Coupling“, also ein Abkoppeln von China, kann es nicht geben und sollte auch nicht angestrebt werden. Mit dem von der Bundesregierung propagierten „De-Risking“, dem Minimieren des Risikos in den Beziehungen zur Volksrepublik, sollte man es ernst meinen. Davon kann bisher in der deutschen Wirtschaft noch keine Rede sein.
Die deutsche Bundesregierung hat Mitte Juli 2023 ihre China-Strategie veröffentlicht. Worin sehen Sie die Essenz und was ist an dem Konzept richtungsweisend?
„Wir sind realistisch, aber nicht naiv“, hat Außenministerin Annalena Baerbock gesagt, als sie die China-Strategie vorstellte. Das ist ein gutes Motto. Leider sind sich die Ampel-Parteien in der China-Politik oft nicht einig. Es wäre gut, wenn sie einen gemeinsamen Kurs finden würden. Beim inzwischen bekannten Dreiklang – China sei zugleich „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“ – wird es auf Dauer nicht bleiben können. Darüber, was China für uns wirklich ist, wird aber am Ende in Peking entschieden, nicht in Berlin.
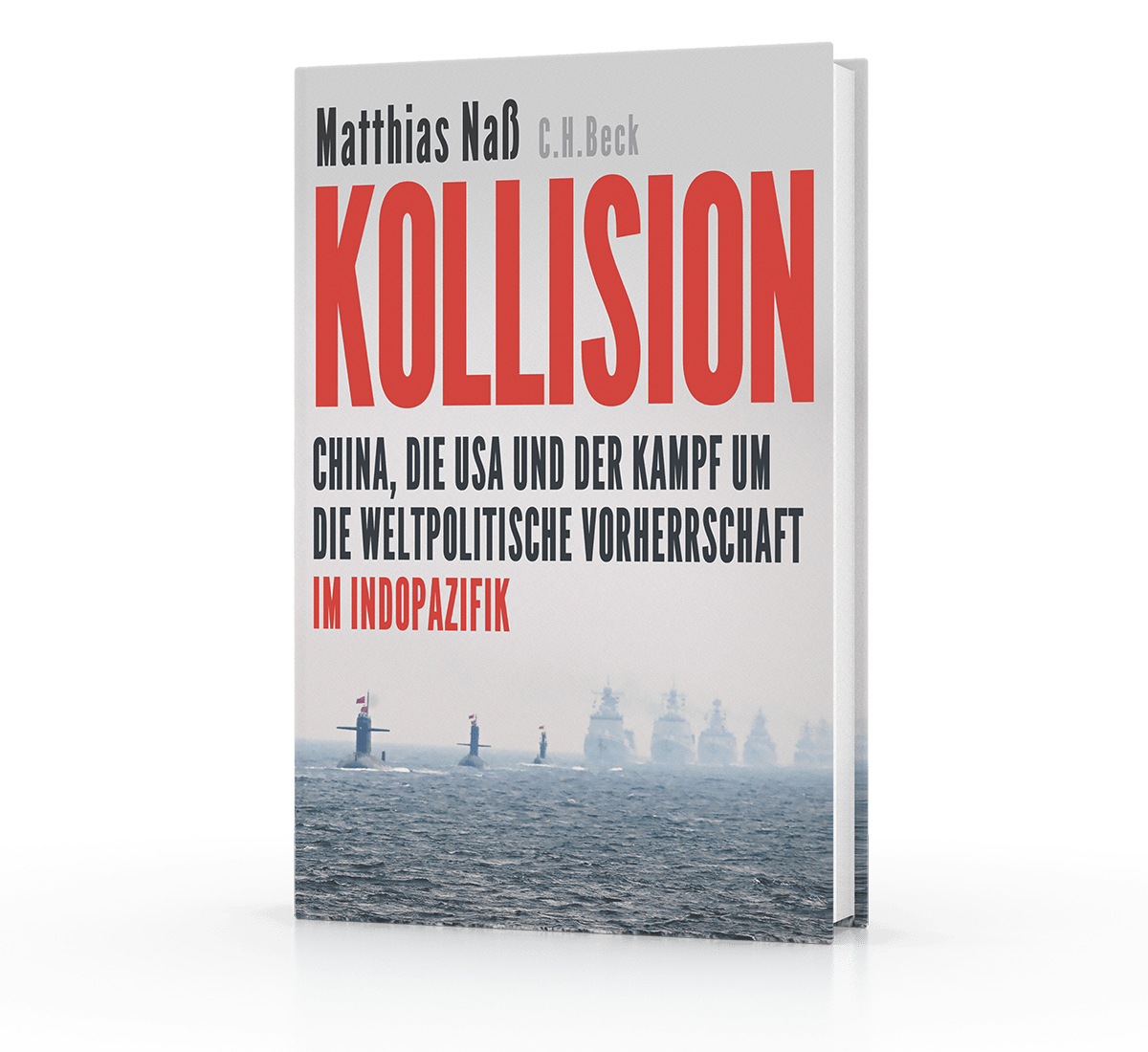
 280 Lesepunkte sammeln
280 Lesepunkte sammeln




