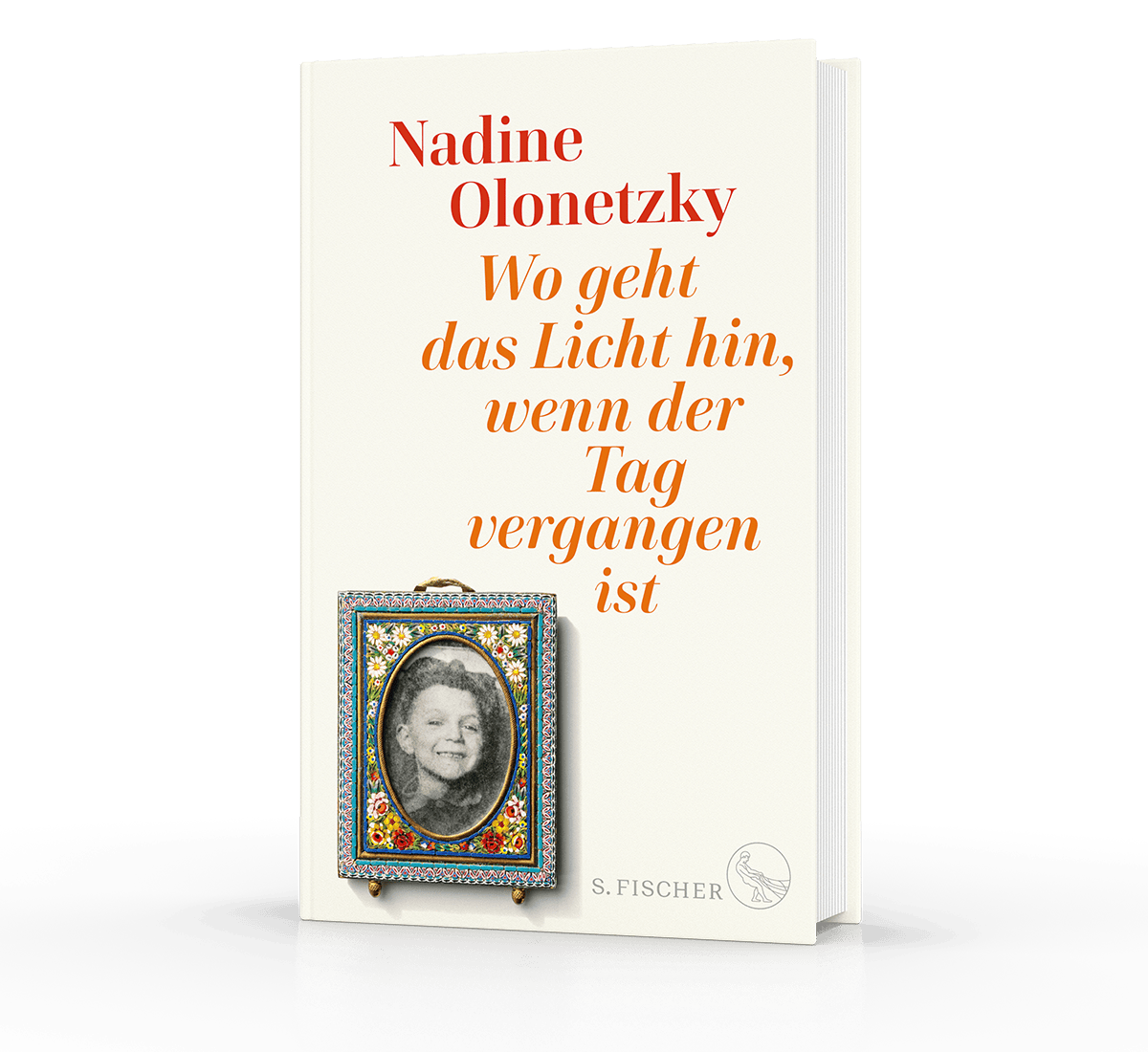Auch als eBook auf Hugendubel.de
 250 Lesepunkte sammeln
250 Lesepunkte sammeln
Hineingeboren wurde Nadine Olonetzky 1962 in eine gutbürgerliche Familie in Zürich. Als freie Autorin schreibt sie u.a. für das Kulturmagazin „du“, die „NZZ am Sonntag“ und das Medienatelier „Kontrast“. Dass ihrem Vater Benjamin am 1. September 1943 die Flucht vor den Nazis in die Schweiz gelang, wusste sie. Jedoch fand sie erst 2020 heraus, dass der jüdische Teil ihrer Familie mit der Bundesrepublik Deutschland jahrelang um Entschädigung rang – und begab sich auf eine Spurensuche.
Wann und wodurch wurde Ihnen bewusst, dass es jüdische Wurzeln in Ihrer Schweizer Familie gibt?
Das war immer klar. Das Jüdische hatte die gleiche Selbstverständlichkeit wie das Christliche; Religion im engen Sinn war aber nicht wichtig. Wichtig waren jüdische Witze, jiddische Ausdrücke und Geschichten und jüdisches Essen. Und natürlich wurde mir das Jüdische auch durch die Besuche meiner Verwandten klar, die Mitbringsel aus Israel dabei hatten und Ivrit sprachen.
In Ihrer Kindheit stand der Chanukka-Leuchter neben dem Weihnachtsbaum. Wie haben Sie die Verbindung beider Kulturen erlebt?
Das war einfach schön – und vollkommen normal. Darüber dachte ich nicht nach, es gehörte zum warmen Durch- und Nebeneinander der Kulturen.
In Ihren frühen Jahren haben Ihre Eltern Ihnen Geschichten von Isaac B. Singer vorgelesen. Wie haben diese Erzählungen Sie beeinflusst oder geprägt?
Ich liebte und liebe die Geschichten sehr. Sie sind voller starker Bilder, absurder Szenen und Witz, auch voller Melancholie und Tragik. In meiner Lieblingsgeschichte muss sich ein kleiner Junge mit seiner Ziege in einem Heustock verstecken. Durch meine Recherchen erfuhr ich dann, dass sich mein Vater auf der Flucht auch im Heu versteckte. Als kleines Kind habe ich Singers Geschichten intuitiv verstanden, war verzaubert und lachte über die irrsinnige Dummheit der „Weisen“, die darin vorkommen. Dass die Geschichten auch vielschichtige Bezüge zur Verfolgungs- und Fluchtgeschichte unserer Familie haben, erkannte ich erst durch die Arbeit an meinem Buch.
„Die Geheimnisse hausen in den Lücken.“
Ein Einstieg in Ihre Familienrecherche waren Fotoalben, Sie sprechen von „Familienereignissen in Fragmenten“. Was empfinden Sie, wenn Sie heute diese Bilder betrachten?
Alle lieben die Fotografie dafür, dass sie im Familienalltag das Glück verewigen kann. Doch die Fotografie hatte für meinen Vater noch eine Bedeutung: Nachdem er alles verloren hatte, hielt er alles fest – Menschen, Landschaften, Dinge. Er musste alles in ein Bild verwandeln, in ein Ding, er musste alles dingfest machen. Ihm schien alles, so empfinde ich es, besonders fragil, bloß die Reflexion eines im Luftzug zitternden Lichts zu sein. Jeden Augenblick konnte sich alles ändern. Diese Dringlichkeit dringt zu mir durch, wenn ich die Bilder betrachte. Und die Geheimnisse hausen in den Lücken zwischen den sichtbaren Dingen und führen dort ein Eigenleben.
„Wenn Du alt genug bist …“ Mit diesem Satz haben sowohl Ihr Vater als auch Ihre Mutter Ihr kindliches, vorsichtiges Nachfragen abgeblockt. Wollen Erwachsene damit nur ein vielleicht unangenehmes Thema beenden oder soll das tatsächlich ein Schutz für das Kind sein?
Meine Eltern wollten mich in Schutz nehmen, ganz bestimmt. Gleichzeitig musste sich mein Vater selbst in Schutz nehmen vor seinen Erinnerungen (und meine Mutter stand da hinter ihm). Dennoch ahnte ich durch diesen Satz, dass etwas unvorstellbar Schreckliches geschehen war, etwas, dass alle Dimensionen gesprengt hatte. Das Unerzählte geisterte herum in unserem Haus, in unseren Seelen. Doch mein Vater konnte mit mir nicht darüber sprechen – wie viele andere, die das Gleiche erlebt hatten, auch nicht mit ihren Kindern reden konnten.
Ihr Vater hat eine schwere Last mit sich herumgetragen. Können Sie mit dem Abstand und Ihrem Wissen von heute einige seiner Verhaltensweisen anders einordnen?
Durch das Lesen seiner Korrespondenz mit dem „Landesamt für die Wiedergutmachung“, in der es unter anderem um seine Arbeitslagerhaft und die Flucht geht, habe ich vieles erfahren, was ich nicht wusste. Und ihn deshalb besser verstanden, ja neu kennengelernt. Viel Irrationales, Beängstigendes, das im Raum schwebend unseren Alltag mitbestimmte, bekam einen Grund, einen Boden.
„Mein Vater war die Liebe ihres Lebens.“
Ihre Mutter konnte die Scheidung kaum verwinden. Was hat sie am meisten getroffen?
Mein Vater war die Liebe ihres Lebens, und die Scheidung eine große Verletzung, obwohl die letzten gemeinsamen Jahre schwierig waren. Mich hat in diesem Zusammenhang die Frage interessiert, weshalb sie es nicht schaffte, sich mit dem Erlittenen so auseinanderzusetzen, dass sie Frieden damit finden konnte.
Als Sie 15 Jahre waren, die Eltern schon lange geschieden, hat Ihr Vater Ihnen, fast wie in einem Ausbruch, auf einer Parkbank im Botanischen Garten Details, teils auch nur Fragmente, über seine Herkunft erzählt. Würden Sie sagen, er erhoffte sich Erleichterung? Oder wollte er Ihnen tatsächlich einen Schlüssel zur Familiengeschichte überreichen?
Beides. In dem Gespräch auf der Parkbank und auch in dem Tagebuch, das er für mich schrieb, bis du selbst weiterschreiben kannst, wie es darin heißt, steckte – wohl unbewusst – ein Auftrag: Die Geschichte zu erzählen, wenn er es nicht kann. So empfinde ich es heute, wobei mich das, was geschah, ja auch geprägt hat.
„Während die einen den Garten beobachten, müssen andere fliehen.“
Sie unterbrechen Ihre Erzählung immer wieder, indem Sie Eindrücke aus Ihrem Garten einweben. Ein Akt des Luftholens für Sie und vielleicht auch für die Leser:innen?
Es sind Passagen, die mir und den Leser:innen Pausen geben, ja. Aber es geht mir auch darum, von parallel existierenden Wirklichkeiten zu erzählen, die das Leben generell ausmachen: Während die einen den Garten beobachten, müssen andere fliehen. Oder: Während man nach einem Verlust trauert, geht das Alltagsleben weiter. In manchen Menschen ist diese Gleichzeitigkeit mehrerer Gefühlswirklichkeiten zugespitzt. Die traumatische Vergangenheit liegt in der Tiefe der Seele und kann so präsent sein wie die friedliche, glückliche Gegenwart.
Der Garten bzw. die Natur unterliegt auch einem Zeitlauf. Wie empfinden Sie diesen Jahreszeitenwechsel?
Mit den Gartenpassagen wollte ich auch einen Gegensatz zur linear vergehenden Zeit schaffen, in der etwas geschieht, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Obwohl Vorgänge in der Natur auch brutal sein können, kann man im Kleinen des Gartens das Große der Lebenszyklen beobachten: ein Werden, Sein und Vergehen und wieder Werden, das ohne Bedeutungsschwere oder Kitsch beruhigt, tröstet, heilt.
„Diese Geschichte war da, als ich zur Welt kam.“
„Geschichte wird vererbt – mit Ängsten und Befürchtungen“ schreiben Sie. Was genau hat Ihnen die jahrelange Recherche und Aufarbeitung der Familienhistorie so wichtig gemacht? Welche Emotionen haben Sie dabei geleitet?
Diese Geschichte war da, als ich zur Welt kam. Ob ich sie haben will oder nicht – sie hat mein Leben geprägt. Deshalb wuchs irgendwann das Bedürfnis, sie so genau wie möglich in Erfahrung zu bringen. Während der Recherchen machte ich die verschiedensten Stimmungen durch: Ich las (und reiste) mit Neugier, Mut, Spannung, mit Fassungslosigkeit, Schmerz, Wut, Angst, und es gab Momente, in denen ich über die Absurdität lachen musste, die mir in der Korrespondenz entgegenkam. Am Ende dominierte Erleichterung. Eine Befreiung von dieser Geschichte gibt es nicht, sie gehört zu mir, zu uns. Die menschenverachtenden Begriffe der Nazis kehrten in der demütigenden bürokratischen Nachkriegs-Korrespondenz mit dem „Landesamt für die Wiedergutmachung“ in einer Variation wieder. Mit diesen Wörtern arbeitete ich und zeigte den Kontrast zur Sprache auf, in der mir mein Vater auf der Parkbank von dem erzählte, was geschehen war: Er sprach in einfachen, undramatischen Sätzen. Ebenso sind die zürichdeutschen und jiddischen Ausdrücke, die für mich einen warmen und liebevollen Klang haben, ein sprachlicher Gegenpol.
Ihre Eltern haben „das Schweigen zu einer Mauer gestapelt“. Ein Kind kann diese Mauer nie zum Einsturz bringen. Aber als Erwachsene haben Sie alles getan, um die Geschichte zu ergründen. Geht es Ihnen heute damit besser?
Heute vieles zu wissen und nicht nur zu ahnen, ist gut. Und auch das, was nie geklärt werden kann, stehenlassen zu können.
„Es war eine schwere Reise im November.“
Sie sind sogar an die wichtigen Orte gefahren, nach Stuttgart und auch nach Izbica in Polen oder Olonets in Russland. War das für Sie ein Versuch, eine Verbindung zu Ihren Vorfahren herzustellen?
Olonets wollte ich sehen, um etwas über unsere Herkunft zu erfahren, ja. Es war eine schöne und heitere Reise im Sommer. Nach Izbica bin ich gefahren, um zu erfahren, was vom Transitghetto bzw. „KL“ noch sichtbar ist; heute lebt in Izbica eine polnisch-christliche Bevölkerung, das jüdische Schtetl ist verschwunden. Es war eine schwere Reise im November. Im Buch verbinde ich die Vergangenheit und Gegenwart mehrerer Orte, das ist mir wichtig: Was geschah damals und was ist heute davon zu sehen?
Denken Sie heute, Ihr Vater hatte nach 1945 auch kleine glückliche Lebensphasen?
Aber sicher! Mein Vater hatte sehr viel Vitalität, Resilienz, Humor und auch den Mut, sich jahrelang mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen – sowohl juristisch in seinem Kampf mit dem „Landesamt für die Wiedergutmachung“ als auch in den Gesprächen mit dem Psychologen, der sich in Zürich um die Emigranten kümmerte, wie der Ausdruck damals lautete. Dass Glück und Trauer, Heiterkeit und Schmerz, Erleichterung und Scham gleichzeitig existieren, kennen alle, die Kriegs- und Fluchterfahrungen haben. Der Alltag ist schön, in seinem Unterboden lauert jedoch die Angst, wieder alles zu verlieren.