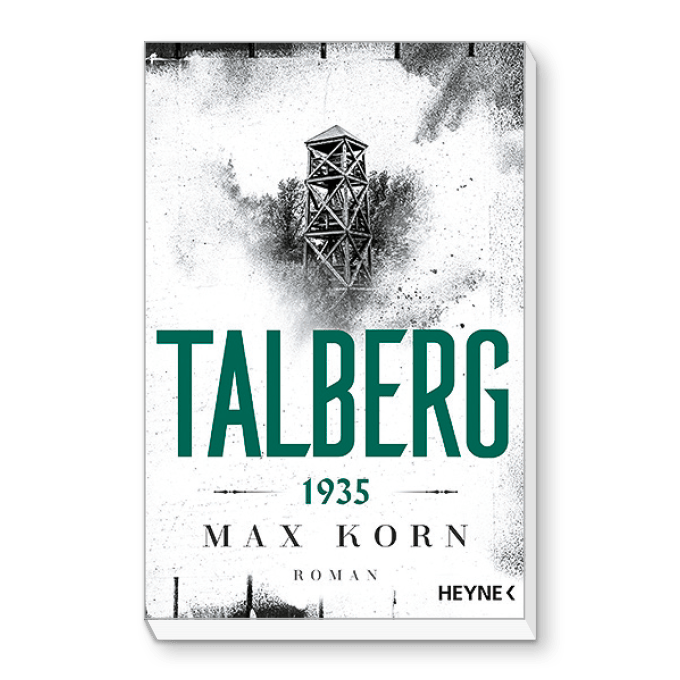Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 150 Lesepunkte sammeln
150 Lesepunkte sammeln
Bis auf das Stichwort Bestsellerautor verraten Sie nichts über sich. Warum haben Sie sich für ein Pseudonym entschieden?
Um die Fans einer Krimireihe, die in Lissabon spielt, nicht zu sehr zu verwirren. Oder auch jene, die unter meinem richtigen Namen humorige Bayernkrimis erwarten.
Pseudonyme provozieren erfahrungsgemäß Spekulationen. Dazu verführen Sie am Ende Ihres neuen Buches „Talberg – 1935“ mit Ihrem Dank an die Autorenkollegen vom „Club der fetten Dichter“. Eine heiße Spur, um Ihre Identität zu erahnen? Oder ein Holzweg?
Nun, der sagenumwobene Club der fetten Dichter hat aktuell sieben aktive Mitglieder, was die Rätselei um meine Person etwas eingrenzt.
„Wie die Freimaurer unter den Literaten.“
Was verbindet Sie mit diesem Dichterclub?
Wir sind vermutlich so etwas wie die Freimaurer unter den Literaten, weshalb ich nicht wirklich darüber sprechen darf. Ich kann nur so viel verraten, dass man, sofern man das immens komplizierte und schwierige Aufnahmeritual übersteht, Mitglied auf Lebenszeit bleibt. Und dass fett nicht mit adipös gleichzusetzen ist.
„Talberg“ führt in den Bayerischen Wald, wo Sie aufgewachsen sind. Wie würden Sie die Gegend beschreiben?
Rau – aber auch wunderschön.
Was haben Sie aus Ihrer Kindheit und Jugend am schönsten in Erinnerung?
Abgeschiedenheit im positiven Sinn. Meine Kindheit empfinde ich rückblickend als absolut sorglos. Wir hatten herrliche Sommer und schneereiche Winter und eine Art von Freiheit, die in der heutigen Zeit ihresgleichen sucht. Man könnte auch sagen, ich wuchs fernab von allem Übel auf. Aber vielleicht habe ich alles, was nicht so großartig war, auch einfach vergessen. Als Jugendlicher war es dann natürlich noch mal etwas anderes. Da war Freiheit gleichgesetzt mit Führerschein. Wie singt Georg Ringsgwandl so treffend: „Der Baumarkt und die Tankstelle und die Diskothek; San erst im übernächsten Dorf, und des ist ganz weit weg.“
„Oma und Opa erzählten schaurigste Geschichten.“
Und was verursacht Ihnen Gänsehaut, wenn Sie zurückdenken?
Tatsächlich verstanden es Oma und Opa, schaurigste Geschichten so zu erzählen, dass ich jedes Wort für bare Münze nahm. Und vermutlich taten die beiden das ebenfalls, was es noch viel gruseliger machte.
Waren Sie eigentlich mal Ministrant?
Ich selbst war nie Ministrant, aber ich kannte natürlich Jungs, die sich dafür in den Dienst der Kirche begaben – die meisten vermutlich auf Drängen der Eltern. Wir wurden dennoch auf jede erdenkliche Weise missioniert, die katholische Kirche war allgegenwärtig. Und wie schon bei Oma und Opa, hat man auch da alles geglaubt. Und als Neunjähriger Sünden gebeichtet, die man nicht begangen hatte. Aber wer zur Kommunion wollte, musste halt vorher zum Beichten. Das war definitiv eine der schlimmsten Erfahrungen meiner Kindheit. Rückblickend ist es nicht verwunderlich, dass ich Religion ablehne … Was natürlich nicht heißt, dass ich mich als Schriftsteller nicht für jegliche Form des Esoterischen interessiere.
Was inspirierte Sie zu Ihrem „Talberg“-Projekt?
Zündfunke war freilich ein Besuch im echten Thalberg vor etwa drei Jahren, bei dem ich feststellte, dass im Großen und Ganzen alles noch immer so ist, wie ich es in Erinnerung hatte. Als wäre der Faktor Zeit an diesem Ort nicht existent. So ein Gedanke ist ein gefundenes Fressen für einen Autor. Und in der Tat fühlte ich mich bei jedem meiner darauffolgenden Besuche besonders inspiriert, ohne konkret benennen zu können, was genau das auslöste. Ich wusste einfach, dass dies der Ort ist, wo meine Geschichten spielen sollen.
Was waren Ihre wichtigsten Quellen?
Womit wir wieder bei den Geschichten von Oma und Opa wären. Dazu kommen eigene Erinnerungen an Geschehnisse aus meiner Kindheit. Ganz viel Unterstützung gab es auch von meiner Mutter.
„Die Mystik, die mich umfing.“
Dass Sie bei Ihrem Roman-Talberg keine 1-zu-1-Abbildung des echten Ortes Thalberg beabsichtigen, zeigt schon die leichte Abwandlung der Schreibweise, das fehlende H. Was hat Ihnen die Rückkehr dennoch wichtig gemacht? Was interessiert Sie bei Ihren Recherchen vor Ort am meisten?
In will natürlich niemandem auf den Schlips treten und schon gar nicht die Thalberger verärgern, weil dort bestimmt ausschließlich wundervolle Menschen leben. Thalberg ist lediglich eine Vorlage und hat nichts mit dem Talberg aus dem Roman gemein, mal abgesehen von der geografischen Lage und einer ähnlichen Struktur des Dorfes. Gefangen hat mich jedes Mal aufs Neue die ländliche Abgeschiedenheit, das raue Klima und die Mystik, die mich umfing, immer wenn ich in den letzten Jahren dort vorbeischaute und recherchierte.
Was macht das Dorf zum idealen Schauplatz beziehungsweise Erzählkosmos für Ihr „Talberg“-Projekt?
Mich als Autor machte vor allem neugierig, dass der Ort in all den Jahren keine nennenswerte Entwicklung erfahren hat. Dass kaum Leute zugezogen waren, aber auch keine erkennbare Abwanderung erfolgt war. Offenbar blieb man, aus welchen Gründen auch immer, weitgehend unter sich. Aus erzählerischer Sicht finde ich diese Form der Isolation extrem spannend.
Welchem Plan folgen Sie bei Ihrer „Talberg“-Trilogie?
Es war mir wichtig, ein Abbild dieses Ortes zu unterschiedlichen Zeiten zu schaffen, und zwar in einem Rahmen, der für mich erzählerisch nachvollziehbar war, weil ich auf die Berichte und Geschichten von Zeitzeugen zurückgreifen konnte.
„Viel Potenzial für Geschichten.“
Das geheimnisvolle Geschehen im Auftaktband trägt sich 1935 zu. Was ist für Sie als Autor das Spannende speziell an diesem Jahr?
Die Grundidee ist, dass ich von der Gegenwart aus (in der der 3. Band spielt) jeweils rund vierzig Jahre in der Zeit zurückgehe. Womit ich mit Band eins in den 1930er Jahren landete. In einer Epoche, in der auch meine Großeltern eine Familie gründeten. Abgesehen davon enthalten die Jahre zwischen den zwei Weltkriegen ohnehin viel Potenzial für Geschichten.
Ihr Roman beginnt im nächtlichen Wald am Friedrichsberg, im Volksmund „Veichthiasl“. Was hat Sie bei Ihrem Rechercheausflug auf den Aussichtsturm am meisten beflügelt?
Wer sich die lohnende Mühe macht, auf den Friedrichsberg hinaufzusteigen, dem erklären Schautafeln auf dem Gipfel unter anderem auch die Geschichte der drei Aussichtstürme, die dort oben über etwa ein Jahrhundert hinweg entstanden sind. Die Frage, die sich mir stellte: Warum baut man einen Turm auf einen Berg, der weder in militärischer noch in wissenschaftlicher oder in touristischer Hinsicht relevant ist? Bei so einer Frage fangen die Zahnräder im Schriftstellerhirn besonders laut zu rattern an.
Rund um den rätselhaften Tod des Dorflehrers Wilhelm Steiner erzählen Sie aus wechselnden Perspektiven. Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgewählt?
Meine bisherigen Romane sind dafür bekannt, dass ich grundsätzlich aus einer einzigen Perspektive erzähle. Max Korn wollte da mal was anderes ausprobieren.
Zur Protagonistin machen Sie Elisabeth, die Witwe des Dorflehrers. Was ist für sie das Reizvolle an diesem Frauencharakter?
Tatsächlich habe ich erstmals aus der Sicht einer Frau geschrieben und hinterher bereut, dass ich damit so lang gewartet habe. Elisabeth ist eine starke und für die damalige Zeit sehr emanzipierte Frau. Das ist sicher der besondere Reiz an dieser Figur, weil sie vor allem in Hinblick auf einen Ort wie Talberg besonders polarisiert.
„… wer einem kleinen Kreis an Menschen ausgeliefert ist …“
Was die Dorfbevölkerung anbelangt, könnte man an Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ denken. Was hatten Sie im Sinn?
Die in erster Linie durch die Geografie bedingte Isolation habe ich bereits angesprochen. Wer in dieser Weise einem kleinen Kreis an Menschen ausgeliefert ist, muss Wege finden, sich damit zu arrangieren, um nicht in die Außenseiterrolle zu geraten.
Nicht zuletzt ist es eine Geschichte von Außenseitern, oder? Welche Typen oder Charaktere interessieren Sie da besonders?
Meiner Ansicht nach funktioniert beim Leser eine Romanfigur nur, wenn sie überzeichnet ist. Ihre Taten, Ansichten oder auch das Aussehen müssen zu einem gewissen Grad von einer Person des realen Lebens abweichen, damit sie polarisiert oder so sehr liebgewonnen wird, dass man alles über sie wissen möchte. Am spannendsten für mich sind dabei immer die dunklen Charaktere, weil die in ihrer Bösartigkeit immer noch ein Stück über das Vorstellbare hinausgehen können.
Was ist aus Ihrer Sicht das Zentrum von Talberg?
Während man sich in der Kirche vermutlich eher verstellt, offenbart man im Wirtshaus, durchaus auch leichtfertig, seinen wahren Charakter. Wahrscheinlich braucht es beides, wenngleich ich nicht abwägen möchte, an welchem der beiden Orte mehr gelogen wird.
„Ich wollte Johannes im realen Leben nicht begegnen.“
Bei welcher Szene oder welcher Romanfigur war Ihnen beim Schreiben am unheimlichsten zumute?
Obwohl ich Johannes geschaffen habe, tut er zuweilen Dinge, die mich entsetzen. Ich wollte ihm nicht im realen Leben begegnen.
Sprachlich haben Sie eine Glanzleistung vollbracht, um die Region und die Zeit zu spiegeln. Wie sind Sie vorgegangen, um die richtige Tonlage zu finden und zu verinnerlichen?
Erwähnte ich schon, dass ich im Keller eine Zeitmaschine stehen habe?
Was sind Ihre drei Lieblingsbegriffe aus der niederbayerischen Sprachwelt?
Vorferd = vorletztes Jahr,
kuawon = kuhwarm (in der Regel bezogen auf die Milch, die direkt aus dem Euter kommt)
arschlen = rückwärts
Wie lautet die charakteristischste einheimische Aussage über das Leben in Talberg?
„Mia san vom Woid dahoam.“
Wie würden Sie Ihre Pläne für die beiden nächsten „Talberg“-Bände auf den Punkt bringen?
Sprachliche Glanzleistung beibehalten.