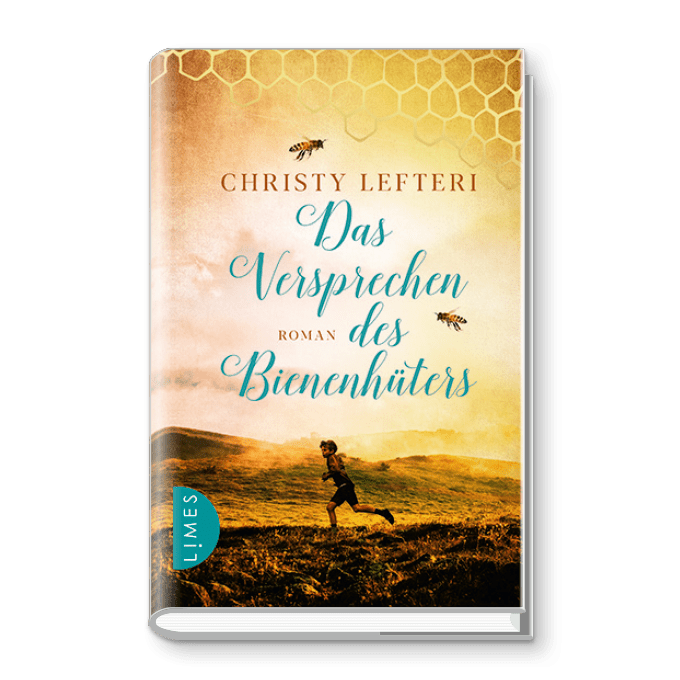Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 200 Lesepunkte sammeln
200 Lesepunkte sammeln
MANCHMAL SIND ES kleine Dinge, die aus der Verzweiflung retten, wenn alles verloren scheint. Im Athener Hilfszentrum für Geflüchtete hat Christy Lefteri als Freiwillige tausende Tassen Tee zubereitet, Zuwendung geschenkt oder einfach zugehört, wenn ihr Menschen aus aller Welt schilderten, was sie durchgemacht hatten. Die Geschichten ließen sie nicht mehr los. Aber sie bestärkten in der Autorin aus London auch das Vertrauen in die Kraft des Erzählens als eine Quelle für neuen Lebensmut – die Inspiration für ihren bewegenden Roman „Das Versprechen des Bienenhüters“.
Hintergrund Ihrer Romane sind dramatische politische Umbrüche und die Folgen. In Ihrem Debüt „A Watermelon, a Fish and a Bible“ beispielsweise war es die türkische Invasion auf Zypern 1974. Da gibt es biografische Berührungspunkte, oder?
Mein Vater war Offizier im Zypernkrieg 1974. Er hat Fremde und Freunde sterben sehen und dann jahrelang an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. Ich selbst habe zwar nie einen Krieg erlebt, aber ich konnte den Krieg im Herz und in den Gedanken meines Vaters nachempfinden, wenn er mit uns Kindern zusammen war. Manchmal hatte ich das Gefühl, eine Bombe könnte auf uns fallen und alles um uns würde in Flammen stehen. Ich habe das alles erst verstanden, als ich älter war.
Wie haben Sie sich die Zusammenhänge erschlossen?
Meinen ersten Roman schrieb ich, weil ich die Geschichte Zyperns besser begreifen wollte – vor allem die Auswirkungen der britischen Besatzung auf die Insel und ihre Bewohner. Parallel dazu entstand meine Doktorarbeit. Schwerpunkt war die aufkommende Globalisierung, die postkoloniale Position Zyperns, die antikoloniale Revolte in deren Gefolge …
„Kein Zweifel, dass ich helfen musste!“
Was waren die ersten Schreibimpulse zu Ihrem aktuellen Roman „Das Versprechen des Bienenhüters“?
Im Frühjahr 2016 war ich zu Besuch auf Zypern, der alten Heimat meiner Eltern. Ich saß mit meinem Vater im äußersten Osten am Strand – mit Blickrichtung Syrien. Plötzlich wurde mir das Drama bewusst: Während wir in Sicherheit sind, leiden im Land jenseits des Meeres die Menschen unter einem furchtbaren Krieg. Meine Eltern waren Flüchtlinge des Zypernkriegs 1974, in dessen Schatten ich aufgewachsen bin. Es gab keinen Zweifel, dass ich helfen musste!
Wo und wie sind Sie aktiv geworden?
Ich ging als Freiwillige nach Athen. Im Einsatz war ich im „Faros Hope Center“, einem Zentrum für Geflüchtete, genauer gesagt: einer Art Notaufnahme für Frauen und Kinder.
Schlagzeilen und Fernsehbilder lassen erahnen, wie schwer der Alltag in den Camps ist und an was es alles fehlt. Wie haben Sie es hautnah erlebt?
Ich war fix und fertig. Aber man stellt auf den Überlebensmodus um, funktioniert mittels Adrenalin und dem Bedürfnis zu helfen. Und tatsächlich merkte ich allmählich, wie die Kinder sich veränderten, wie sie anfingen, wieder zu spielen, als ihnen klar wurde, dass sie einigermaßen in Sicherheit waren – dass sie nicht mehr jeden Augenblick mit dem Tod rechnen mussten. Es ist ein überwältigendes Erlebnis, wenn man Kinder in solchen Situationen kennenlernt und spürt, wie sie sich an einen klammern, wenn sie Angst haben, aber auch, wenn sie Vertrauen fassen.
Was hat Sie besonders berührt?
„Ich hab dich lieb“, sagte eines der kleinen Mädchen zu mir. Danach habe ich mehr geweint als in vielen Jahren zuvor, obwohl ich durchaus Verluste erlitten und Schwierigkeiten durchgemacht hatte.
Und was lässt sich Ihrer Erfahrung nach bewirken?
Im „Faros Hope Center“ habe ich vieles mitbekommen, was ich nie vergessen werde. Beispielsweise kam eine Frau mit einem winzigen Baby, das sich kaum noch bewegte. Die Mutter war so traumatisiert, dass sie nicht mehr stillen konnte. Wir befürchteten, dass das Baby sterben würde. Wir taten alles, damit beide wieder zu Kräften kamen. In solchen Situationen wachsen einem die Menschen ans Herz, denen man hilft. Verzweifelt versucht man, die Situation für sie wenigstens etwas erträglicher machen. Als die Mutter zu Kräften kam und sich sicherer fühlte, aß und trank sie schließlich – und konnte auch wieder stillen. So ging es auch ihrem Baby bald viel besser. Leider entwickelt es sich nicht bei allen so positiv. Unsere Hilfe brauchen immer mehr dieser verängstigten, so verloren wirkenden Familien, die hauptsächlich aus Afghanistan und aus Syrien nach Griechenland fliehen.
„Ich verdanke meinem Arabischlehrer viele Einblicke.“
Wie ist Ihr Bezug zu Syrien?
Ich bedauere, dass ich nie die Gelegenheit hatte, Syrien vor dem Krieg zu besuchen. Aber ich verdanke meinem Arabischlehrer viele Einblicke. Er war Übersetzer für die BBC und selbst Geflüchteter aus Syrien. Er hat mir nicht nur die Sprache beigebracht, sondern auch das Vorkriegssyrien beschrieben. Er hat mein Romanmanuskript durchgesehen und sichergestellt, dass alles stimmt. Wir haben uns Karten und Bilder angesehen und die Wege der Romanfiguren genau geprüft. Und er hat mich ermutigt: „Bitte, schreib das Buch zu Ende“, pflegte er zu sagen, wenn wir in unserem kleinen Stammcafé im Londoner Stadtteil East Finchley saßen. Dort waren wir sicher.
Das klingt nach gemischten Gefühlen …
Die Kinder von Athen waren meilenweit weg, der Krieg war meilenweit weg. Aber in unseren Gedanken waren sie es nicht, wirklich nicht. Es ist leicht, sich von der sicheren Umgebung beruhigen zu lassen und zu vergessen. Aber ich konnte sehen, dass mein Arabischlehrer nicht wollte, dass ich vergesse. Er wollte, dass ich mich erinnerte an das, was ich in Griechenland empfunden und gesehen hatte. Ich begann, in meinem Kopf Bilder heraufzubeschwören, alles, was ich erlebt und erfahren und in mich aufgenommen hatte. Die Emotionen, die Ungerechtigkeiten, die zerbrochenen Leben, die gebrochenen Herzen.
Mit welcher Grundidee haben Sie sich ans Schreiben gemacht?
Eigentlich hatte ich zunächst keinen Plan. Aber ich hatte ein Bild vor Augen: ein Mann und seine erblindete Frau, die ihren gemeinsamen Sohn verloren hatten. Die beiden waren im Wohnzimmer ihres zerstörten Hauses. Er überreichte ihr als Geschenk einen Granatapfel, den er im Müll gefunden hatte. Dieses Bild wurde ich nicht mehr los – und die Figuren, der Mann und seine Frau, wurden in mir lebendig und ihre Geschichte ging von da an immer weiter.
Im Mittelpunkt Ihres Romans stehen Afra und Nuri. Warum ein Ehepaar aus Syrien?
Weil ich herausfinden wollte, wie sich eine Beziehung unter traumatischen Umständen entwickelt. Afra und Nuri lieben einander. Die beiden hatten sich ein gemeinsames Leben aufgebaut. Mit ihrem kleinen Sohn Sami waren sie eine glückliche kleine Familie. Aber wenn sie all das verlieren – wie machen sie dann weiter? Was verbindet die beiden dann noch? Ich wollte ergründen, wie sie sich voneinander entfernen oder einander näher kommen, wie einer den anderen trägt – ohne dass es ihnen in der jeweiligen Situation selbst so bewusst ist.
„Alle kommen zu einem großen Essen zusammen.“
Afra und Nuri lebten gesellig in einem großen Kreis – mit ihren Geschwistern, Cousinen, Cousins und Freunden. Welche Traditionen und Rituale erscheinen Ihnen am typischsten? Die gemeinsamen Mahlzeiten? Ist es ein Hoffnungszeichen, als die blinde Afra wieder Brot bäckt?
In der Kultur Zyperns und Griechenlands haben Mahlzeiten im Kreis der Familie große Bedeutung. Wenn ich Zypern besuche, finden wir uns oft zu einem großen Essen auf der Veranda zusammen – mit vielen Verwandten und Nachbarn. Das ist mir also sehr vertraut … Als Afra während des Kriegs in Aleppo Brot backt, tut sie das, weil sie etwas verleugnet: Sie backt es für ihren Sohn Sami – sie will sich seinen Tod nicht eingestehen. An dieser Stelle ist Afra an ihrem Tiefpunkt.
Afra war vor ihrer Erblindung Malerin – ein Augenmensch …
Ich kann mir vorstellen, dass jeder Leser etwas anderes aus dem Buch mitnimmt. Aber in meiner Geschichte geht es oft ums Sehen und was es bedeutet zu sehen: Blindheit, Verleugnung, Selbsttäuschung …
Ob Syrien im Schatten des Krieges, auf der Flucht oder dann in England: Afra und Nuri nehmen die Welt unterschiedlich wahr. Was wirkt da alles auf die beiden ein?
Sie sind beide extrem traumatisiert – jeder auf eine andere Weise. Im Roman geht es darum, wie die Verluste, die sie erlitten haben, sie als Individuen prägen, wie sich das alles auf ihre Beziehung auswirkt – und auf ihre Wahrnehmung der Welt um sich herum. Ihre Reaktionen sind sehr verschieden …
„Die Bienen bringen sie zusammen.“
Nuri hat in Syrien schon früh seine Berufung gefunden – beim Imkerei-Projekt, das er gemeinsam mit seinem Cousin Mustafa zum Wachsen und Gedeihen bringt. Was macht die Symbiose der beiden doch recht unterschiedlichen Männer aus?
Die Symbiose liegt in der Natur. Natur aber bedeutet für beide etwas anderes. Mustafa erinnert sie an die Vergangenheit, sein Haus in den Bergen, seinen Vater, seinen Großvater, seine Mutter. Für Nuri verkörpert sie die Flucht aus der Enge des väterlichen Geschäfts. Mustafa und Nuri waren beide als Kinder einsam – und die Bienen bringen sie zusammen.
Was symbolisieren die Bienen?
Zusammenarbeit und Hoffnung.
Was kann Ihrer Überzeugung nach das Erzählen bewirken angesichts des Verlustes der Heimat, geliebter Menschen und alles Vertrauten?
Geschichten können uns in das Herz und die Gefühle anderer Menschen versetzen und uns ermöglichen zu fühlen, was sie fühlen, die Welt für eine Weile mit ihren Augen sehen. In den dunkelsten Zeiten – in Kriegen, auf der Flucht, bei Verlusten und Zerstörungen – können Geschichten ein wichtiger Weg sein, uns in das Leben von Menschen einzufühlen, die uns sonst fremd bleiben würden. Geschichten können uns die Komplexität menschlicher Gefühle bewusst machen: Furcht und Leid, Liebe und Hoffnung.
Und wie haben Sie Ihre Rolle zwischen Erleben und Erzählen gefunden?
Ich wurde verändert durch die Menschen, denen ich in Athen begegnet bin und durch ihre Geschichten, die ich zu hören bekam. Deshalb wollte ich meine Leser auf eine Reise mitnehmen – auf eine Reise in die Köpfe und Herzen von Afra und Nuri.
Ein Rezept spielt im „Das Versprechen des Bienenhüters“ eine wichtige Rolle: Das „Muhammara“ aus gerösteten Paprika und Walnüssen. Das Rezept für diese Köstlichkeit „á la Nuri“ finden Sie hier: