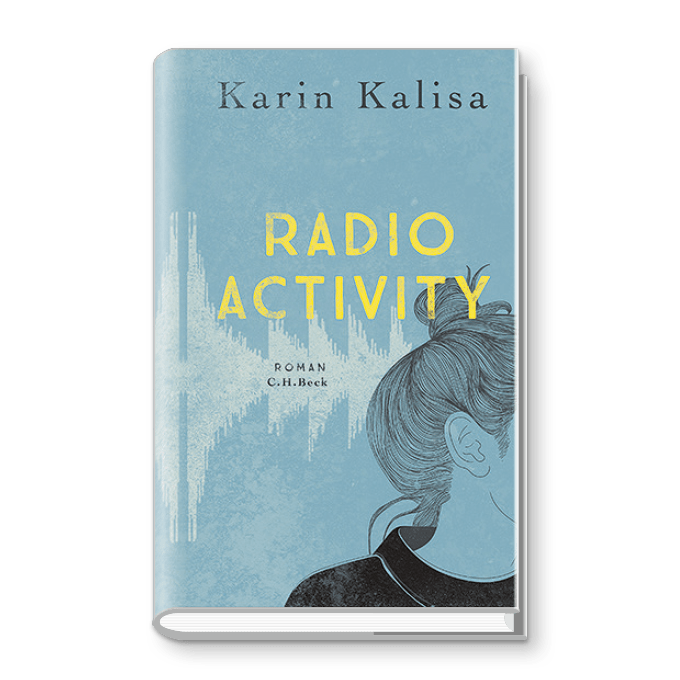Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 220 Lesepunkte sammeln
220 Lesepunkte sammeln
IHR GRANDIOSES DEBÜT „Sungs Laden“ machte die Japanologin und Sprachphilosophin Karin Kalisa als literarisches Ausnahmetalent bekannt. Das moderne Märchen über die vietnamesische Community am Prenzlauer Berg stand 36 Wochen lang auf den Bestsellerlisten. Ein Sensationserfolg, der hohe Erwartungen an das nächste Buch weckte. Diese Herausforderung meisterte Karin Kalisa mit Bravour: Ihr vielschichtiger neuer Roman „Radio Activity“ ist eine Hommage ans Radio. Eine leidenschaftliche Mission für Gerechtigkeit – mit außergewöhnlichem Soundtrack!
„Tee und Teer“ nennt Ihre Protagonistin Nora das Projekt, das siemit ihren Freunden Tom und Grischa gründet: Einen Radiosender! Warum entscheiden sie sich ausgerechnet für dieses nostalgische Medium?
Nostalgisch finde ich das Radio gar nicht. Es gibt doch allerorts eine sehr frische, witzige, junge, auch innovative Radiokultur – die sich ihrerseits mit allen möglichen Sparten von Social Media und digitaler Struktur verbindet: Podcasts, Blogs … Radio ist höchst lebendig.
Was begeistert Sie selbst am Radio?
Radio ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes „Weltempfang“. Auf Reisen habe ich immer meinen batteriebetriebenen Weltempfänger dabei. Ich würde mich nie auf zuverlässige Strom- und WLAN – Versorgung verlassen. Außerdem ist für jemanden, der sich gern zurückzieht, Radio ein probates Mittel von Information und Teilhabe. Zudem Erholung von visueller Anspannung; man muss nicht stillsitzen. Man kann sich politisch informieren und musikalisch überraschen lassen, während man Quittungen sortiert, Flecken auswäscht oder Blumen umtopft. Genial.
„… Radio ist Weltempfang!“
Musik ist natürlich auch ein großes Thema der drei Radiomacher. Noras Motto: „Mix-it statt Hit-Mix“. Was wären da die fünf Favoriten auf Ihrer ultimativen Playlist? Und warum diese Auswahl?
Mich fasziniert der Gedanke, dass es neben klar definierten Zielgruppen mit klar definiertem Musikgeschmack auch einen gemischten Bereich gibt, der auf spielerische Weise sehr verschiedene Musikgenres verbinden könnte. Dass wir durch die digitale Entwicklung leichten Zugang zu Titeln finden, die ansonsten unauffindbar wären, betrachte ich als ein Geschenk – das anzunehmen wirklich große Entdeckerfreude mit sich bringen kann. Stellen Sie sich vor: Eine mehrköpfige Familie unterwegs, Autoradio, für jeden was dabei, und dann auch noch gut moderiert. Das wäre doch eine echte Konkurrenz zur Endlos-Schlaufe persönlicher Playlists, zumindest zeitweilig. Okay, fünf Titel:
Lina Maly: „Schön genug“
Barbra Streisand und Donna Summer: „No More Tears (Enough Is Enough)“
John Dowland: „Lachrimae“
Sting: „Clear or cloudy“
The Police: „Message in a bottle“.
Sehr verschieden, aber nicht ohne innere Verbindung. Ja, das würde mir gefallen, als Mix-it.
Was macht die besondere, mitunter fast existenzielle Bedeutung des Mediums aus?
Radio ist verlässlich, rund um die Uhr, nahezu allerorts, man fängt vertraute und fremde Sprachen ein, kann Frequenzen wechseln. Weit und breit keine Menschenseele – oder zumindest keine Menschenseele, die einen versteht. In einer solchen Situation wird man auf irgendeiner Frequenz die Stimme eines Menschen vernehmen, der irgendwo in einem Studio sitzt und dafür sorgt, dass die innere oder äußere Vereinzelung aufgehoben wird. Eine der besten Erfindungen in meinen Augen – Ohren, wollte ich sagen.
So verschieden wie die Charaktere, Temperamente, Weltansichten der drei Personen aus dem Gründungsteam, so unterschiedlich sind ihre Vorstellungen vom eigenen Radiosender. Wer spricht Ihnen aus dem Herzen und warum? Ist das Roman-Programm so etwas wie Ihr persönliches Wunschkonzert?
So persönlich ist das Schreiben ja gar nicht; jedenfalls bei mir nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Figuren mit starken Eigeninteressen auftauchen und sich schlichtweg weigern, als Sprachrohr zu fungieren.
Grischas Eltern, die mit ihm von der Schwarzmeerküste nach Deutschland kamen, haben einen Favoriten: „Funkhaus Europa“. Das Besondere?
„Funkhaus Europa“ gibt es ja leider nicht mehr; der Sender „Cosmo“ ist daraus hervorgegangen. Auch gut. „Funkhaus Europa“ war damals eine ziemlich unglaubliche Gründung zwischen den Sendern in Bremen und Köln. Gesendetwurde in 15 Sprachen und ganz nah an den kulturell verschiedenen Lebenswelten, wie sie sich im deutschen Senderaum so zusammengefunden hatten. Ja, Brückenbau on air, könnte man so sagen …
„Für das Verschwiegene eine Sprache finden“
Eine gemeinsame Sprache finden – ob mit oder ohne Worte – einander verstehen, so ein ganz persönlicher Gleichklang: Wie viel näher sind Sie dem Geheimnis gekommen?
Eine Sprache zu finden für das, was verschwiegen wird, zuhören, ganz Ohr sein für das, was sich nicht leicht und laut sagen lässt – eher würde ich dies als das Hauptanliegen des Romans bezeichnen. Gleichklang ist viel weniger das Ziel als Streitbarkeit – etwa, wenn es um die Auseinandersetzungen mit den Zumutungen juristischer Regelungen und Sprachgewohnheiten geht.
In ihrer New Yorker Ballett-Zeit tanzt Nora mit ihrem Freund Toshio zu Janáčeks „Listy duverne“ – „Intime Briefe“. Was kann diese Musik besser zum Ausdruck bringen als Worte?
Nicht besser, aber anders, würde ich sagen. Ein Pas de deux, der nicht dem gängigen Repertoire angehört und für Nora und Toshio eine Möglichkeit bietet, ihrer Nähe und Hingabe Ausdruck zu verleihen. Glück einer körperlichen Zwiesprache, die viel ist, aber eben nicht alles – wie sich zeigt.
Dass Sie Japanologin sind, schimmert auch in Ihrem Roman immer mal wieder durch. Was macht für Sie die Faszination der japanischen Kultur aus?
Eine seltsame Verhaltenheit inmitten der ungeheuren Reichhaltigkeit kultureller Quellen und Bezüge.
Kein Zufall, dass Toshio Nora ein Buch von Kobayashi Issa geschenkt hat, oder? Eine Leseempfehlung?
Möglicherweise doch ein Zufall. Toshio ist eher nicht der Mann, der sich für Leseempfehlungen einspannen lässt, glaube ich … Er wird seine Gründe gehabt haben. Vielleicht einfach auch nur den, dass Kobayashi Issa eine feste Größe der japanischen Literatur ist, an der man einfach nicht vorbei kommt. Seine Kunst ist geprägt von großen persönlichen Verlusten, die er erfahren musste. Schon seit langem ist er auch ins Deutsche übersetzt. Es lohnt sich!
„Zu spät – oder gerade noch nicht …“
Auslöser für Noras Rückkehr nach Deutschland ist der alarmierende Gesundheitszustand ihrer Mutter Annabel. Was zeichnet die Beziehung der beiden aus?
Die beiden sind das, was man eine verschworene Gemeinschaft nennen könnte, fest verbunden, über eine niemals thematisierte „Leerstelle“ hinweg. Unter dem Zeitdruck eines viel zu früh und zu schnell herannahenden Todes gibt es Dinge, die besprochen und versprochen werden müssen. Ein altes Verbrechen, eine frühe Verletzung haben seit langem ihre Spuren durch die Zeit gezogen, und nun fehlt es an Zeit und Möglichkeit, zu ahnden und zu heilen. Zu spät – oder gerade noch nicht zu spät …
Als Nora sich in das Radioprojekt stürzt, verfolgt sie nicht zuletzt eine heimliche persönliche Mission. Was treibt sie im Innersten an und um?
Nora erfährt am eigenen Leib das, was man heute die Weitergabe traumatischer Erfahrungen nennt – und gerät in eine haltlose Wut darüber, dass sich die rechtlichen Instanzen, die sie anschreibt, für die Vorladung des Täters nicht mehr zuständig fühlen und auf die „mechanischen Effekte“ der Zeit gesetzt wird, wo doch offenkundig ist, dass Verbrechen, wie die, die an ihrer Mutter verübt wurden, im Körper und Seele gespeichert werden und über die Zeit verheerende und weitreichende Folgeerscheinungen haben; anerkanntermaßen. Verjährung ist das Wort, das hier zur Debatte steht.
Noras Heimatstadt wird im Roman als „Seestadt“ bezeichnet. Ist es eine Ihrer eigenen Lebensstationen?
Der Roman bildet, worauf ich auch in einem Nachsatz hinweise, keine Biografie ab, auch meine eigene nicht – auch wenn ich weiß, wie das Meer riecht, wie es sich anhört und wie es aussieht, niemals gleich nämlich.
Wie viel Wasser brauchen Sie selbst für Ihr Wohlergehen?
Das Meer mit seinem Grundtakt von Ebbe und Flut kann in all seiner überwältigenden, ewigkeitsnahen Anmutung auch den einen oder anderen Aufruhr der Seele wieder in Takt bringen. Das erfahren viele Menschen so, und auch ich vermisse das Meer, wenn ich ihm längere Zeit fern bin. Andererseits darf man die Flüsse nicht unterschätzen – vor allem nicht die, deren Strom man sich streckenweise anvertrauen kann: den Hochrhein, die Aare. Und natürlich die Seen, die sich idealerweise aus Grundwasser speisen und täglich, im Spiel mit dem Licht, ihre Farbe wechseln … Etwas Wasser sollte in der Nähe sein, ja.
„Musikalische Liaison – vor allem eine Hoffnung.“
Der Schlussakkord ist eine musikalische Liaison – orientalisch angehaucht. Jemenitisch jüdische Tradition meets Hip-Hop. Und vorher „Amen Break“. Ein Credo?
Djamil legt beim Sender „Tee und Teer“ das Trio „A-WA“ auf, drei Schwestern, die mit „Habib galbi“ die israelischen Charts gestürmt haben, einem Lied in jemenitischem Arabisch. Damit grüßt Djamil womöglich seine eigenen Schwestern, die einst mit ihm in Aden einen Untergrund-Sender betrieben haben. Das „Amen break“ wiederum, dessen Wellenform auf dem Cover von „Radio Activity“ abgebildet ist, sind vier Takte eindringlichstes Drum-Solo der Winstons, einer Band, in der schwarze und weiße Musiker zusammenwirkten. Ursprünglich auf eine längst vergessenen B-Seite gepresst, ist dieses Solo zigtausendfach verwendet und variiert wurde, ohne dass es je seine Eindringlichkeit verlorenging. Erst vor wenigen Jahren ist durch ein Crowdfunding etwas von den Einnahmen an die Musiker zurückgeflossen. Es gibt gute Wendungen, Aufbruch, Mut, Rückbesinnung – mit Tempo und Takt. Ein Credo? Vor allem eine Hoffnung.
Nora Tewes nennt sich als Radiomoderatorin Holly Gomighty. Warum ausgerechnet dieses Pseudonym?
Die Idee, in Anlehnung an die Tradition der Seesender, die eigenen Namen zu ändern, entsteht ja eigentlich aus der Sperrigkeit von Grischas Nachnamen heraus. Wenn aus Golightly Gomighty wird, ist das, davon möchte ich ausgehen, erst einmal mehr eine Ansage als eine Anverwandlung – die insgesamt mehr auf Tatkräftigkeit als auf Traumwelten aus ist: „Radio Activity“ eben.
Was erscheint Ihnen wichtiger? Ankern? Oder Leinen los?
Dass Glück, einen Anker auswerfen und bleiben zu dürfen, hält sich vermutlich die Waage mit dem Glück, ihn auch wieder einholen zu können, um auf große Fahrt zu gehen. Und oft stellt sich diese Alternative ja gar nicht so schlicht: einen Anker kann man mit sich und in sich tragen; innere Freiheit, Beweglichkeit und Sesshaftigkeit, schließen einander nicht aus. Alles jedoch nicht ohne den nautischen Grundton: den der Sehnsucht.
Eine Playlist passend zum Roman „Radio Activity“, sowie eine Playlist mit Karin Kalisas besonderen Empfehlungen finden Sie hier: