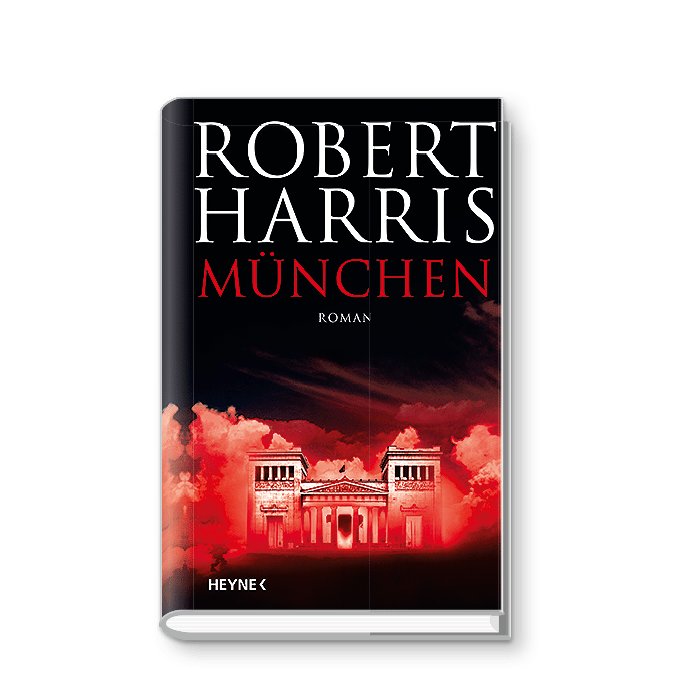Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
Auch als Hörbuch erhältlich
6 CDs, Spieldauer: 450 Min.
Sprecher: Frank Arnold
Random House Audio, 22,– €
 220 Lesepunkte sammeln
220 Lesepunkte sammeln
25 JAHRE Welterfolg: Bei diesem Jubiläum hatte Robert Harris 2017 allen Grund, auch auf die Empörten in Deutschland zu trinken, die 1992 sein literarisches Debüt gründlich missverstanden und zum Hitler-Skandal erklärten. Dass sie vor der Lektüre warnten, erwies sich allerdings als prima Werbung. Der Roman „Vaterland“ wurde bis heute sechs Millionen Mal verkauft und jeder der inzwischen elf Politthriller von Harris ein internationaler Bestseller – übrigens ohne weiteren Wirbel. Sein Renommee als einer der Besten des Genres bestätigt nun auch sein neuester Thriller „München“.
Ihre Thriller schreiben Sie in einem viktorianischen Pfarrhaus in der Idylle von Berkshire. Ist diese Bilderbuchlandschaft für Sie eine Art Detox für Geist und Gemüt?
Wir sind 1993 in dieses Haus eingezogen, gleich nachdem „Vaterland“ herausgekommen war. Seither habe ich hier elf Romane geschrieben. Zwei unserer vier Kinder wurden hier geboren. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. 14 Jahre habe ich in London gewohnt, weitaus lieber ist mir aber das Landleben: die Ruhe, die Weite der Landschaft – und kein Schriftsteller-Klatsch. Das Haus selbst wirkt ziemlich exzentrisch: viktorianische Neogotik mit großen Räumen und hohen Fenstern – und mit viel Platz für unsere Bücher, wohl um die 5.000.
Ihr Anwesen bezeichnen Sie als „das Haus, das Hitler kaufte“.
Als ich mit „Vaterland“ das erste Mal Geld verdiente, fragte ich mich, was ich damit am besten anfangen sollte, und ich beschloss, ein Haus zu kaufen, das – typisch englisch – groß genug für uns alle sein würde, egal was passiert. Das Schönste am Erfolg ist die Unabhängigkeit: Mein ganzes Leben war immer darauf ausgerichtet, keinen Chef zu haben.
2017 ist das 25-jährige Jubiläum Ihres Debütromans „Vaterland“, um dessen Veröffentlichung es Anfang der 90er Jahre – vor allem in Deutschland – einigen Wirbel gab. Welche Erinnerungen haben sich Ihnen besonders eingeprägt? Was fanden Sie am erstaunlichsten?
Buchstäblich jeder deutsche Verlag hat „Vaterland“ abgelehnt, bis es schließlich von Haffmanns angenommen wurde, einem kleinen Zürcher Verlag. Kurz bevor das Buch herauskam, gab es einen sehr langen und feindlichen Artikel im „Spiegel“. Natürlich hat das das Buch so richtig ins Gespräch gebracht. Plötzlich wollten es die Leser kaufen, um sich selbst eine Meinung bilden. Es war eine aufregende Zeit. Es gibt im Grunde nichts Besseres für einen Schriftsteller, als wenn gesagt wird, sein Buch sei zu gefährlich, um es zu veröffentlichen. Heute fragt man sich: Warum die ganze Aufregung?
Deutsche Geschichte ist offenbar eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Ihre Politthriller. Was fesselt Sie so nachhaltig?
Mich beschäftigen bestimmte Fragen: Wie kam es dazu? Und wenn es einmal so gekommen ist, kann es dann wieder dazu kommen? Die Bedeutung dieser Fragen wird ja nie geringer, im Gegenteil, gerade jetzt scheinen sie dringlicher denn je. Beispielsweise wenn man in die USA blickt, wo bei Aufmärschen Hakenkreuzfahnen mitgeführt wurden.
Haben Sie sich während Ihrer langjährigen und intensiven Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte auch mit der Sprache vertraut gemacht?
Ich spreche kein Deutsch. Aber ich kann es inzwischen lesen – langsam und mit Hilfe eines Wörterbuchs. Die große Schwierigkeit für einen Nicht-Muttersprachler wie mich ist natürlich, dass die Sätze so lang sind und dass die Bedeutung sich gewöhnlich erst ganz am Ende erschließt. So muss man von hinten nach vorne arbeiten …
„Das schönste am Erfolg ist Unabhängigkeit“
Wie waren denn die Recherchen für Ihren neuen Thriller „München“?
Das Münchner Abkommen beschäftigt mich seit mehr als 30 Jahren. 1988 beispielsweise interviewte ich Lord Home, der Chamberlains politischer Berater war und ihn nach München begleitete. Er war – abgesehen vom Übersetzer Dr. Schmidt – der Einzige, der in Hitlers Wohnung dabei war, als sich Chamberlain und Hitler trafen. Ich hatte das Privileg, die Räume im 2. Stock eines Gebäudes am Prinzregentenplatz zu besichtigen, in dem heute eine Polizeiinspektion untergebracht ist. Die Schlafzimmer für Hitler und seine Nichte Geli Raubal waren durch ein gemeinsames Bad verbunden – was mich vermuten ließ, dass sie eine Affäre miteinander hatten.
Und die politische Kulisse?
Der Führerbau, jetzt die Hochschule für Musik und Theater, in der Arcisstraße ist ebenfalls erstaunlich gut erhalten: Ich war darauf gefasst, Hitler und Chamberlain jeden Augenblick um die Ecke kommen zu sehen … Überrascht hat mich, dass die Konferenz 1938 während des Oktoberfests stattfand. So war die Stadt voll von Menschen, die am lautesten Chamberlain zujubelten – was Hitler in Wut versetzte.
„München“ beginnt am 27. September 1938. Was veranlasste Sie, diesen Ausgangspunkt zu wählen?
Ich versuche immer, einen Roman so zu schreiben, dass er den kürzest möglichen Zeitraum schildert. So wird er spannungsgeladener. In „München“ sind es drei Tage. Und der erste davon, der 27. September 1938, war der Tag, an dem jeder dachte, es würde Krieg geben. So wurde daraus die Geschichte, wie Chamberlain darum kämpfte, den Krieg zu vermeiden. In Ihrem Roman ringen die Staatsoberhäupter, ihre Minister und Diplomaten um die Kräfteverhältnisse in Europa.
Wie beurteilen Sie die Motive und das Selbstverständnis der politischen Akteure damals? Und wie sehen Sie im Vergleich dazu die Politiker unserer Zeit?
Am meisten reizte es mich, über die Münchner Konferenz zu schreiben, weil sie in Wahrheit das genaue Gegenteil dessen war, was die meisten Leute glauben: Hitler sah sie als eine Niederlage, Chamberlain hielt sie für einen Sieg. Ich glaube nicht, dass Chamberlain eine realistische Alternative hatte, den Krieg zu vermeiden. England war so bald nach 1914-18 weder militärisch noch psychologisch bereit für einen Krieg. Ich glaube, jeder Politiker von heute hätte das gleiche getan wie Chamberlain. Was Konfliktlösungsfähigkeit durch die Politik anbelangt, ist das Vertrauen gerade allgemein nicht groß.
Was sagt dazu der langjährige politische Journalist Robert Harris?
München im Herbst 1938 war der erste große Krisengipfel der Geschichte. Ich glaube, wir haben seither gelernt, die Dinge besser zu organisieren.
Kamen Sie nie in die Versuchung, selbst in der Politik aktiv zu werden?
Nein, nicht ernsthaft.
Worin besteht für Sie der Reiz der Auseinandersetzung mit solchen Gestalten?
Ich empfinde große Sympathie mit politischen Führern wie Cicero und Chamberlain, die sich bemühen, Frieden und Ordnung aufrecht zu erhalten in einer Welt voller gewalttätiger Psychopathen. Helden und große Männer sind mir zutiefst suspekt. Wenn es um Macht geht, kommt man an Donald Trump gegenwärtig nicht vorbei.
Ist er für Sie ein interessanter Kandidat als Romanfigur?
Trump in einem Roman wäre unmöglich – niemand würde glauben, dass es so eine Figur zum Präsidenten der Vereinigten Staaten bringen könnte. Er trotzt jedem überlegten, künstlerisch verantwortungsvollen Erzählen. Einer der Gründe für die Fülle an echten historischen Details in meinen Romanen ist, dass die Wirklichkeit im Allgemeinen interessanter ist als alles, was man erfinden könnte. Ich verwende die Fiktion als Werkzeug, um die Wirklichkeit verständlich zu machen. Trump ist ein Protagonist unserer postfaktischen Zeit.
Wie ergeht es einem so detailgenauen Autor wie Ihnen angesichts der zunehmenden Verbreitung „alternativer Fakten“?
Es ist zutiefst beunruhigend. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, in einer Welt zu leben, in der er es nur noch mit „Fakten“ zu tun bekommt, die seine bereits bestehenden gefühlsmäßigen Vorurteile bekräftigen. In letzter Konsequenz macht das die Demokratie unmöglich. Mich erinnert es an das Ende der Römischen Republik, als skrupellose Millionäre und Aristokraten den Mob aufhetzten, die Elite im Senat zu vernichten.
In „München“ rücken Sie den britischen Premierminister Neville Chamberlain ins Rampenlicht. Ihr Fazit?
Chamberlain war in keiner Weise der schwache oder naive Charakter, als den ihn die meisten sehen. Er war zäh, zielstrebig, recht rücksichtslos: Was er machte, war „Realpolitik“. Sein Fehler war – seltsamerweise genau wie bei Hitler – die Eitelkeit. Er hatte ein persönliches Sendungsbewusstsein, das ihn gelegentlich blind für die Realität machte.
An Chamberlains Seite stellen Sie einen gewissen Hugh Legat, der im Außenministerium arbeitet. Was hat es mit dem jungen Mann auf sich?
Schon seit vielen Jahren wollte ich einen Roman über einen britischen Beamten schreiben, der mit Chamberlain zusammenarbeitet und der sich im eigenen Privatleben dem gleichen moralischen Dilemma gegenübersieht wie England: An welchem Punkt sagt man, bis hierher und nicht weiter? Wie lang ist man zur Beschwichtigungspolitik bereit? Hugh Legat sorgt sich um seine Ehe. Sie selbst sind seit rund 30 Jahren mit der Journalistin und Romanautorin Gill Hornby verheiratet. Das Geheimnis einer guten Ehe? Beschwichtigungspolitik.
Ihr Kommentar zum Brexit?
Ich bin entsetzt über den Brexit. Großbritannien hat immer Glück gehabt – seit 1.000 Jahren keine feindliche Invasion, siegreich in Kriegen und sogar in der Lage, ein Weltreich aufzugeben, ohne ein nationales Trauma auszulösen. Jetzt mache ich mir Sorgen, unser Glück könnte uns verlassen haben. Die Eigenschaften, die ich an meinen Landsleuten am meisten schätzte – Pragmatismus, Toleranz, Mäßigung, Stabilität, Ironie – scheinen verschwunden zu sein. Nicht nur Europa, sondern die Weltlage erscheint zunehmend instabiler.
Ihre Prognose? Und Ihre größte Hoffnung sowie Ihre schlimmste Befürchtung?
Mein Motto ist: Die Dinge sind nie so gut oder so schlecht, wie man glaubt. Ich hoffe, dass mein Eindruck zutrifft, dass die Menschen im Grunde anständig und vernünftig sind. Ich befürchte allerdings, dass es in der Geschichte Zeiten gibt, in denen nach einer langen Zeit des Friedens und der Stabilität – gewöhnlich ungefähr nach 70 Jahren – eine menschliche Neigung bemerkbar wird, sich zu langweilen und mal etwas Riskantes zu unternehmen. Viellicht stehen wir am Beginn solcher Zeiten.
Geschichte ist für Sie ein Lebensthema. Glauben Sie noch daran, dass die Menschen aus Geschichte lernen?
Ich habe den Verdacht, Menschen lernen die Lektionen aus der Geschichte für ein oder zwei Generationen – und dann geraten die Lektionen in Vergessenheit und müssen neu erlernt werden. Ich habe eine Theorie: Seit Tausenden von Jahren gibt es ungefähr den gleichen Prozentsatz von Psychopathen, Heiligen und Genies. Vermutlich besteht die Aufgabe der Gesellschaft darin, die Psychopathen von der Macht fernzuhalten. Aber von Zeit zu Zeit – das Jahr 1933 in Deutschland ist das offenkundigste Beispiel – kommen die Psychopathen an die Schalthebel der Macht.
Um die historischen Fakten herum spielen Sie Schicksal. Welche Spielregeln haben Sie sich dafür gegeben?
Historische Romane sind nicht das gleiche wie wissenschaftliche Geschichtsschreibung. Für einen Roman muss man verdichten und vereinfachen – um klare Umrisse zu bieten, wo es in der Wirklichkeit vielleicht gar keine gab. Die einzige Regel, die ich mir gegeben habe ist die, den Kern der Wahrheit nicht zu verfälschen, nicht etwas zu schreiben, von dem ich definitiv weiß, dass es nicht passiert ist. Bei allen meinen historischen Romanen, von „Imperium“ bis „München“, habe ich die Hoffnung: Was ich geschrieben habe, KÖNNTE zumindest so passiert sein.
Ihren Roman „Ghost“ haben Sie als „Sorbet zwischen den schweren Gängen“ bezeichnet. Was wäre denn „München“ in der Menüfolge?
Ich habe die Hoffnung, dass „München“ ein zufriedenstellender Hauptgang ist.