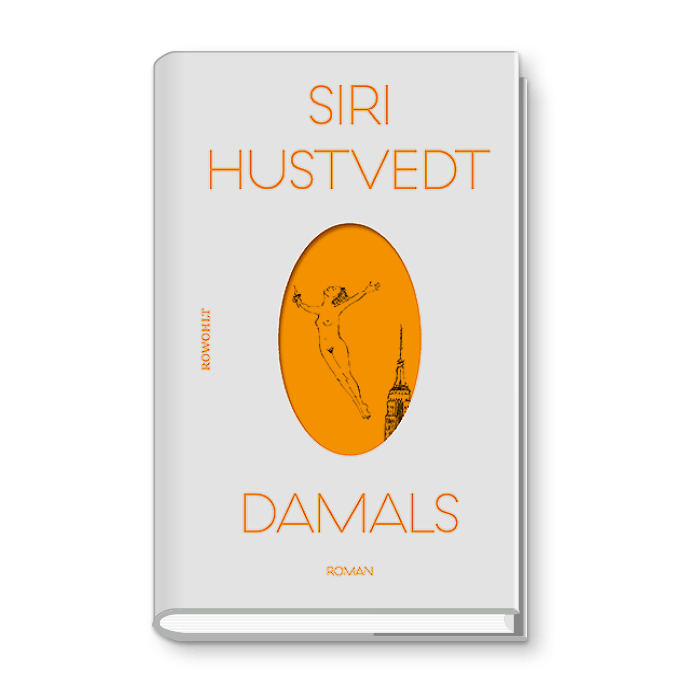Auch als eBook auf hugendubel.de erhältlich
 240 Lesepunkte sammeln
240 Lesepunkte sammeln
Ein Ideen-Feuerwerk, das seinesgleichen sucht: Mit ihrem neuen Roman macht Siri Hustvedt ihrem Ruf als eine der bedeutendsten amerikanischen Autorinnen alle Ehre. „Damals“ hat es als Gesamtkunstwerk richtig in sich. Es wirkt wie ein Selbstporträt der Schriftstellerin in einem Spiegelkabinett – virtuose Erzählkunst, die mit Leichtigkeit und Brillanz alle ihre großen Themen ins Spiel bringt: von Geschlechterkampf und Versöhnung bis zu Mysterien wie Zeit und Erinnerung. Intelligentes Lesevergnügen inklusive Illustrationen mit Schlüsselfunktion!
Auf dem Cover Ihres neuen Buches steht „Roman“. Aber beim Lesen zeigt sich bald, dass die weibliche Hauptperson, die S.H. genannt wird, nicht nur die Initialen mit Ihnen gemeinsam hat, sondern auch sonst ziemlich viel. Kein Zufall, oder?
Das Buch ist ein Roman, aber ich wollte den Eindruck von Lebenserinnerungen erwecken und mit den unzähligen Querverbindungen zwischen Fiction und Non-Fiction spielen. Ich habe wiederholt erklärt, dass Erinnerung und Imagination keine gegensätzlichen, sondern verwandte Fähigkeiten sind …
Was folgt daraus?
Einen Roman zu schreiben heißt, sich an etwas erinnern, das nie passiert ist. Das Romanschreiben ist eine Form des sich Erinnerns, aber was man dabei ausgräbt, sind nicht Fakten der Vergangenheit, es ist vielmehr eine Geschichte, die eine Gefühlswahrheit widerspiegelt. Außerdem glaube ich nicht, dass die inneren Bilder der Erinnerung und die der Dichtung qualitativ verschieden sind. Dass das so ist, dafür gibt es deutliche Beweise in der Hirnforschung. Dichtung arbeitet in der Erinnerung, und Erinnerung arbeitet in der Dichtung. Es gibt keine unverfälschte Erinnerung im Gehirn. Erinnerungen unterliegen Veränderungen – jedes Mal, wenn wir sie wieder hervorholen. Und sie werden durch Gefühle geformt und neu geformt. Menschen vergessen, was ihnen nicht wichtig ist.
„Damals“ bietet verschiedene Lesarten oder Deutungen an, etwa als Erinnerungsbuch. Es beginnt mit einer Rückschau auf das Jahr 1978. Was macht diese Zeit so spannend für Ihr Romanprojekt?
Ich kam im Herbst 1978 nach New York. Es war eine Zeit der Entdeckungen und einer neu entdeckten Unabhängigkeit in meinem Leben, die für mich wichtig geblieben ist. Mehr als 40 Jahre später stehen mir Veränderungen, die sich in mir seit meiner Jugend vollzogen haben, deutlich vor Augen – eine größere Reife und ein gewachsenes Verständnis, sicher, aber darüber hinaus ein Gefühl der Befreiung und der Selbstgewissheit.
Und New York?
Ich sehe auch, wie sehr sich die Stadt verändert hat. Ich kam in ein New York, das knapp eine Finanzkrise überlebt hatte, eine Stadt, die dabei eine Million Einwohner überwiegend aus der Mittelschicht verloren hatte, eine Stadt, die am Zerfallen war, aber auch eine Stadt voller künstlerischer, rebellischer Energie. Ich wollte unbedingt wieder an diesen Ort, der seither verschwunden ist.
Wer inspirierte Sie damals?
Ich bin auch Dichtern und Künstlern und Schriftstellern und Wissenschaftlern begegnet. Die Anregungen, die sie mir gaben, waren in den meisten Fällen mehr als inspirierend. Manhattan ist bürgerlicher geworden, beträchtlich sicherer und viel ruhiger. Es ist nicht mehr der wilde, heruntergekommene, kreative, subversive Ort, den ich kannte. Junge Künstler sind woanders hingezogen, nach Brooklyn und Queens.
Auch das Erinnern an sich scheint ein großes Thema zu sein – beziehungsweise unterschiedlichste Tücken dabei und nicht zuletzt das Abhandenkommen von Erinnerungen. Was an diesem oft rätselhaften Phänomen interessiert Sie besonders?
Das ist ein komplexes Thema, aber es ist tatsächlich ein zentrales Thema des Romans. Wir erinnern uns. Wir vergessen. Wir erinnern uns falsch. Wir erzählen uns Geschichten über uns, um zu erklären, warum etwas passierte, wie es passierte. Das ist wesentlich für die menschliche Erfahrung, aber sich erinnern heißt nicht direkt wahrnehmen. Es ist die Wiederkehr der Vergangenheit in der Gegenwart, nicht als identische Kopie dessen, was war, sondern als eine Version davon.
Welche Rolle spielt dabei die verstreichende Zeit?
Die Zeit ist, wie die meisten Philosophen seit Aristoteles herausgefunden haben, ein unmöglicher Begriff. Ist sie in unserem Inneren, lediglich durch das Bewusstsein bestimmt? Oder ist sie etwas außerhalb von uns? Bewusste Erinnerungen werden immer konstruiert oder neu konstruiert. Es gibt jedoch andere Formen der Erinnerung, zum Beispiel traumatische körperliche Erinnerungen, die sich unwillkürlich einstellen. Minnesota, also S.H., im Roman erlebt in ihren Träumen nach einer Gewalterfahrung eine belastende Erinnerung.
In Ihrem Roman wirkt das Erinnern mitunter wie eine bunte Assoziationskette, etwa wenn S.H. Ereignisse aus ihrer Kindheit einfallen und dann eine Art Eigendynamik immer weitere Ereignisse lebendig werden lässt. Was ist – literarisch und psychologisch – das Interessante daran?
Der menschliche Geist geht assoziativ vor, und kann – da haben Sie Recht – wenn er zu einem bestimmten Zeitabschnitt zurückgeht, zuvor vergessene Erinnerungen hervorbringen. An sich ist das interessant, aber ich bilde nicht nur die Wirklichkeit ab. S.H.s bunte Kette von Erinnerungen soll dem Roman als Ganzem dienen, der zum Teil untersucht, wie die männliche Herrschaft über die weibliche im Innern errichtet wird, wie Frauen oft Ungerechtigkeiten und Demütigungen hinnehmen, weil ihnen ein entsprechender Verhaltenskodex und entsprechende Gefühle eingeschrieben wurden.
Wie meinen Sie das?
Im allerersten Satz meines Roman heißt es: „Damals wusste ich nicht, was ich heute weiß: Wenn ich schrieb, wurde ich auch geschrieben.“ S.H.s Kindheitserinnerungen lassen sich nicht trennen von dem, was ihr als junger Frau in New York zustößt, aber sie können auch nicht abgesondert werden von ihr als der älteren Frau, die die gleichen Erinnerungen und Ereignisse wieder zusammenstellt. Und vor allem lässt sich keine dieser Erinnerungen trennen von S.H.s fiktivem Charakter ihrer feministischen Heldin, die sie aus der frühen Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgegraben hat, der Dada-Poetin und Künstlerin Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, deren Kunst ignoriert, herabgesetzt oder lächerlich gemacht wurde.
„Ich bin skeptisch bei den meisten Autobiografien …“
Wieviel Selbstironie oder Skepsis ist da eigentlich im Spiel, wenn Sie im Roman über das autobiografische Schreiben nachdenken? Worauf spielen Sie mit den Kartoffelpfannkuchen aus der New Yorker Anfangszeit an?
Ich habe zahllose Memoiren gelesen, die sich wie Romane lasen, mit allem, was dazugehört: seitenweise Dialoge, absurd detaillierte Beschreibungen von Gesichtern und Zimmern und Kleidern, die allenfalls ein Gelehrter im Kopf hätte behalten können. Ich bin höchst skeptisch, was die meisten Autobiografien angeht, da sie dazu neigen, die Biologie der Erinnerung als solche zu übergehen. Andererseits bleiben Ereignisse, die extreme Gefühle auslösen, oft lebendig im Gedächtnis. Zum Beispiel habe ich besondere Einzelheiten aus den Minuten unmittelbar nach einem schweren Autounfall bestens in Erinnerung. Im gegensatz dazu sind Kartoffeln auf einem Teller ein Teil unseres Daseins, der gewöhnlich in die alltägliche Amnesie entschwindet.
S.H. hat viel vor in New York. Beispielsweise will sie ausprobieren, ob die Ideen, die ihr durch den Kopf spuken, tatsächlich romantauglich sind. Wir erleben beim Lesen gewissermaßen die Geburt als Autorin mit – wie sie am Schreibtisch grübelt und was sie schreibt. Worum geht es Ihnen bei diesen Einblicken?
Ja, das stimmt, die Form des Buchs zeugt von der Entstehung einer Autorin. Die Leser meines Romans lesen Bruchstücke des komischen Romans, den meine Heldin S.H. zu schreiben versucht. Die Leser sind überdies eingeweiht in das Tagebuch, das S.H. führte, als sie 23 und 24 war, was im Laufe der Jahre 1978 und 1979 die Form einer weiteren Art von Roman annimmt, einem autobiografischen Roman, der wieder in einem anderen Stil geschrieben ist – und stark von S.H.s Lektüre beeinflusst. Und zu guter Letzt werden all diese Texte gerahmt von der alt gewordenen Autorin, die in der Gegenwart des Romans schreibt, 2016/17 also, während des Präsidentschaftswahlkampfs und nach der Amtseinführung Donald Trumps. Im Vorgang des Erinnerns faltet sich die Zeit in sich selbst zusammen.
Verstehen Sie „Damals“ als Entwicklungsgeschichte der Schriftstellerin S.H.?
Ja, das Buch handelt von einer jungen Schriftstellerin, aus der eine alte wird, die sich mit der Zeit durch Phantasie aus der Abhängigkeit heraus und in die Freiheit schreibt. Menschen sind fantasiebegabte Wesen. Wir können uns in die Vergangenheit versetzen, aber wir können uns auch in die Zukunft hineinfantasieren. Das ist nicht einfach eine Sache müßiger Hirngespinste oder von Ablenkung. Es kann entscheidend sein dafür, wer wir sind und was aus uns wird. Die komplexe Form des Buchs, die ich erst verstanden habe, nachdem ich es fertig hatte, ähnelt einem Origami. Es fängt an als lineares, schlicht darstellendes Erzählen, ein einfaches Blatt Papier. Dann aber fängt die Geschichte an, mit Zeit und Erinnerung und Fiktion zu spielen, und faltet sich in sich zusammen und entfaltet sich wieder, bewegt sich vom Erinnern zum bloßen Vorstellen und wieder zurück. Wiederholungen bestimmter Sätze nehmen neue Bedeutungen an, je nachdem, wann sie geschrieben werden. Alte Bedeutungen verändern sich und werden neu mit jeder Bewegung des Buchs. Zum Schluss hat das einfache Blatt Papier neue Dimensionen angenommen und ist zu einem Vogel im Flug geworden.
„Unwillentliches Belauschen ist eine bizarre Form von Intimität …“
„Damals“ ist auch die Geschichte eines Rätsels, das S.H. immer mehr in den Bann zieht. Es beginnt damit, das S.H. durch die papierdünnen Wände ihres Appartements allabendlich wundersame Klagelaute ihrer Nachbarin Lucy Brite zu hören vermeint. Was hat es mit diesen Wahrnehmungen auf sich?
Lucy Brite, die rätselhafte stöhnende Nachbarin, ist eine weitere Verkörperung der lebhaften Fantasie unserer Heldin. Schon bevor S.H. Lucy überhaupt sieht, hört sie die eigenartigen Monologe der Frau und stellt sich vor, wie sie aussieht und was es mit ihrer Geschichte auf sich hat. Natürlich gleicht das sehr dem Lesen: Wir sehen Wörter und hören sie im Kopf, aber wir müssen die Bilder, die dazugehören, erfinden. S.H. hört durch die Wand Bruchstücke eines Romans und füllt die Leerstellen mit verschiedenen Deutungen. Sie wird dabei unterstützt durch ihre vier Freundinnen, von denen jede eine Theorie entwickelt, um Lucys rätselhaftes Reden zu erklären. Ich selbst hörte jedenfalls jede Menge von Reden und Geschrei durch die Wände meines ersten Apartments in New York. Unwillentliches Belauschen ist eine bizarre Form von Intimität, die keine Intimität ist.
Wie schon die junge S.H. nimmt es auch die reife Schriftstellerin sehr genau mit Worten – und mit dem, was ungesagt bleibt. Beispielsweise im Gespräch mit dem Arzt, der über den Zustand ihrer 92-jährigen Mutter berichteten soll. Da sind Sie in Ihrem Element, denn Sie befassen sich ja sehr intensiv mit medizinischen Fragen und vor allem mit Neurologie. Worin bestehen hier die größten Defizite und Herausforderungen?
Ich fühle mich in der Welt der Neurologie, der Psychiatrie und der Neurobiologie zuhause und habe auf diesen Gebieten in den letzten Jahren regelmäßig Vorträge auf Konferenzen gehalten und Aufsätze veröffentlicht. Ich habe großes wissenschaftliches Interesse und in diesen Fachgebieten im Laufe der Jahre eine Menge gelernt, unter anderem eine Art zu denken, die mir eine größere Beweglichkeit beim Reflektieren verliehen hat.
Und Sie ziehen noch wesentlich weitere Kreise …
Weil ich auch Literatur, Philosophie und Geschichte studiert habe, war ich in der Lage zu erkennen, was bei bestimmten naturwissenschaftlichen Modellen fehlt oder schwach ist. Bei den meisten dieser Probleme handelt es sich um die Basisannahmen oder die Paradigmen, auf denen die Forschung beruht. Ich habe darüber ausführlich in „Die Illusion der Gewissheit“ geschrieben. Inzwischen bin ich überzeugt, dass die Naturwissenschaften auf die Geisteswissenschaften angewiesen sind, und die Geisteswissenschaften auch auf die Naturwissenschaften …
„Geschichten erzeugen ein geistiges Bindegewebe.“
Was macht das Erzählen für Sie essenziell?
Das Geschichtenerzählen scheint eine universelle menschliche Aktivität zu sein. Wir sind dazu verurteilt, in Geschichten zu leben, ob wir es wollen oder nicht. Durch das Erzählen ergibt sich für uns der Sinn der Zeit, der unseres Lebens und der des Lebens anderer. Wir verbinden eine Sache mit einer anderen und dann mit einer weiteren, um eine lineare und logische Abfolge zu schaffen. Es ist eine Form, Bedeutung zu erzeugen, die nicht notwendigerweise die wirkliche Welt wiedergibt, aber sie bereichert dennoch unsere eigene Welt. Geschichten erzeugen ein geistiges „Bindegewebe“, nach dem die Menschen dringend verlangen.
Worin sehen Sie die erlösende Wirkung, die das Erzählen im besten Fall entfalten kann?
Es kann nicht genug betont werden, dass viel von dem, was wir erleben, getilgt werden muss, um eine Geschichte zu erzählen. Eine wahre phänomenologische Darstellung von auch nur 30 Sekunden eines Erlebnisses – im Gegensatz zu einer Erfahrung – ist unmöglich. Was therapeutische Verfahren angeht, so scheint das Geschichtenerzählen zum Beispiel für Traumaüberlebende heilsame Wirkungen zu entfalten. Das liegt daran, dass die Sprache eine distanzierende Wirkung hat. Sie ist nicht Erlebnis, sondern eine Wiedergabe des Erlebten, die den Erzähler von der unbearbeiteten Unmittelbarkeit in den symbolischen Bereich transportieren kann.
„Wir verwenden literarische Texte als Sprungbretter.“
Sie geben Seminare für Medizinstudenten …
Genau, ich habe am Weill Cornell Medical College in New York eine Dozentur für Psychiatrie. Wir, die psychiatrischen Fachkräfte und ich, treffen uns im Krankenhaus und befassen uns mit „Narrativer Psychiatrie“. Wir verwenden literarische Texte – sowohl Poesie als auch Prosa – als Sprungbretter für Diskussionen über die psychiatrische Praxis. Emily Dickinson, Franz Kafka, Sylvia Plath, F. Scott Fitzgerald und viele andere haben uns schon als Katalysatoren gedient, um über Fragen des Selbst und des Anderen nachzudenken – einschließlich des psychoanalytischen Konzepts der Übertragung, der Dynamik der Macht in der Medizin und der Grenzen diagnostischer Kategorien. Die Ärzte in meinem Kurs waren und sind wunderbare Denker und Schreiber.
Warum liegt Ihnen das Erzählen in der Medizin so am Herzen?
Das Erzählen verfügt über Formen von Bedeutung, wie sie nicht dargestellt werden durch die eingeschränkten diagnostischen Kategorien, die im Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders – kurz: DSM – im Wesentlichen aus Listen von Symptomen bestehen. Die Literatur kann – zusammen mit der Geschichte der Psychiatrie – dazu verhelfen, das Arzt-Patienten-Verhältnis auf eine Art und Weise neu zu formulieren, die oft erstaunlich ist.
Klartext spricht im Roman die Mutter von S.H. Eine Hommage? Auch an Ihre eigene Mutter? Und was zeichnet deren Lebenshaltung aus? Und was die Philosophie dahinter?
Ja, bei S.H.s fiktiver Mutter handelt es sich mehr oder weniger um meine eigene Mutter. Meine echte Mutter verliert – wie die Romanmutter – allmählich ihre jüngeren Erinnerungen, was natürlich höchst relevant für das Thema des Romans ist. Wie meine eigene Mutter nennt sich die Mutter von S.H. „philosophisch“. Philosophie gemäß der echten wie der fiktiven Mutter lässt sich reduzieren auf die Feststellung: „Wir alle leiden und wir alle sterben.“ Dieser Satz wird verschiedene Male im Roman wiederholt, ebenso wie eine Reihe anderer Sätze, was über den Text hinaus Bedeutung schafft. Ein anderer über Lucy ist: „Sie will, dass der Arsch stirbt“. Die Resignation des Satzes der Mutter steht im Gegensatz zu der Wut des anderen Satzes. Sowohl Resignation als auch Zorn bewirken im weiteren Verlauf des Romans das Ihre. Es gibt viele solcher Sätze, aber der wichtigste ist vielleicht der: „Aus einer Geschichte wird eine andere“. Dieser Satz ist der Schlüssel für die vielfachen Transformationen des Buchs.
Heimisch fühlt sich S.H. von Anfang an in der Welt der Bücher und Gelehrten, in Bibliotheken und Buchhandlungen. Ist „Damals“ gewissermaßen Ihre Autobiografie als Leserin?
Mit wenigen Ausnahmen ist die Leserin S.H. im Roman die Leserin Siri Hustvedt. Ich habe mich wirklich während meines ersten Jahres in New York mit Husserl abgemüht, obwohl ich – anders als S.H. – bereits in einem höheren Semester war. Ich habe von mir selbst übernommen, was meine Heldin als Kind liest und schreibt. Bücher habe ich von klein auf geliebt.
„Bücher öffnen und schließen sich wie Türen.“
Was macht Bücher für Sie so faszinierend?
Ich glaube fest, dass Lesen eine Erweiterung des Bewusstseins darstellt, dass es einem Zugang verschafft zu einer Vielfalt von Sichtweisen, die man sonst nicht entdecken würde. Bibliotheken waren für mich Zufluchtsstätten. Sechs Stunden am Tag verbringe ich mit Schreiben und drei oder vier mit Lesen. Wenn ich reise, lese ich. In meinem Roman sind Bezüge auf andere Bücher dicht gesät. Der erste Satz lautet: “Vor Jahren vertauschte ich die weiten, flachen Felder des ländlichen Minnesota mit der Insel Manhattan, um den Helden meines ersten Romans zu finden.“ Der Held wird zu einem problematischen Konzept im Buch. Ein Zitat aus Sternes „Tristram Shandy“ taucht früh auf, eine Warnung an die Leserin oder den Leser, dass der Roman, den sie oder er vor sich hat, kein konventioneller Roman sein wird. Reale Landschaften und Städte werden zu imaginären. Bücher öffnen und schließen sich wie Türen. Don Quixote, der Leser der Leser, ist eine zentrale Figur im Buch, die dann mit Madame Bovary verschmilzt, mit Catherine Morland (aus Austens „Die Abtei von Northanger“ und mit Arabella, der Heldin des „The Female Quixote“ aus dem 1752 veröffentlichten Roman von Charlotte Lennox. Die Bewegung von einem Geschlecht zum anderen ist dabei kein Zufall.
Zu den Besonderheiten von „Damals“ gehören die Bilder, die Sie eingestreut haben. Mal erinnern sie an Cartoons, dann vielleicht an Chagall, Symbolismus oder Kunsttherapie. Was inspirierte Sie?
Ich bin so froh, dass Sie das fragen. Die Zeichnungen sind wesentlich. Sie fungieren als optische Zeichensetzung und sie dienen dem Erzählen als Ganzem. Einige von ihnen widmen sich dem Romanthema „GROSSER MANN“, auf äußerst ironische Art. Zu diesen „Großen“ gehören Einstein als Gott der Physik und popkulturelle Ikone des Geistes schlechthin, Paul de Man, der Professor der Vergleichenden Literaturwissenschaft in Yale, dessen Ruf befleckt wurde durch faschistische Tätigkeiten während des Krieges. Dann Donald Trump als populistischer Psychopath, Marcel Duchamp, dem man das berühmte Urinal zurechnet, das in Wahrheit ein Werk der Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven war, und Sherlock Holmes als fiktive Verkörperung des Rationalen.
Und die weiblichen Versionen?
Die anderen Zeichnungen graben Stollen in das Gelände der FRAU. Zu ihnen gehören Kritzeleien aus S.H.s Notizbüchern, eine Fotografie der Totenmaske der Baroness, eine Illustration aus dem Roman innerhalb des Romans sowie eine aus „Der Schlüssel Salomos“, einem Zauberbuch aus dem 15. Jahrhundert.
Was ging Ihnen bei all dem durch den Kopf?
Mir ist im Laufe der Zeit klar geworden, dass die Menschen durch Konventionen so eingeschränkt sind und dass sie oft nicht sehen, was direkt vor ihren Augen ist. Es ist selten, dass zeitgenössische Romanciers Illustrationen in ihre Bücher einfügen, und im Allgemeinen auch selten, dass Schriftsteller ihre Illustrationen selbst anfertigen. Wenige wissen, was sie aus meinen Bildern machen sollen, aber leider fragen sie nicht! Es gab vier meiner Illustrationen in meinem Roman „Der Sommer ohne Männer“ – kein Mensch hat sie je mir gegenüber erwähnt.
„Ich bin fast übergeschnappt vor Glück …“
„Damals“ wirkt wie ein Ausschöpfen der unterschiedlichsten literarischen oder künstlerischen Spielräume …
Es wäre wunderbar, wenn wenigstens ein paar Leser so viel Spaß beim Lesen des Buchs hätten wie ich beim Schreiben. Ich habe alles gegeben und bin fast übergeschnappt vor Glück – wie ein Kind, das ausgelassen durch die Gegend rennt.
Was hat Ihnen dabei das größte Vergnügen bereitet?
Das Vergnügen beim Schreiben des Buchs – eines Buchs, das keineswegs ganz und gar „happy“, sondern auch traurig und zornig und verletzt ist – also dieses Vergnügen entspringt dem intensiven Gefühl meiner künstlerischen Freiheit und meiner geistigen Beweglichkeit, die jetzt größer ist als jemals zuvor. Im Februar bin ich 64 geworden, am selben Tag, an dem meine Mutter 96 wurde. Jedes Mal, wenn ich ein Buch fertig habe, bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich die Zeit dazu hatte. Das Leben lässt sich nicht vorhersehen. Es endet – manchmal endet es plötzlich. Das Wissen um den Tod schafft Dringlichkeit und Leidenschaft. S.H. sagt, sie „schreibt gegen den Tod an“. Ich auch.