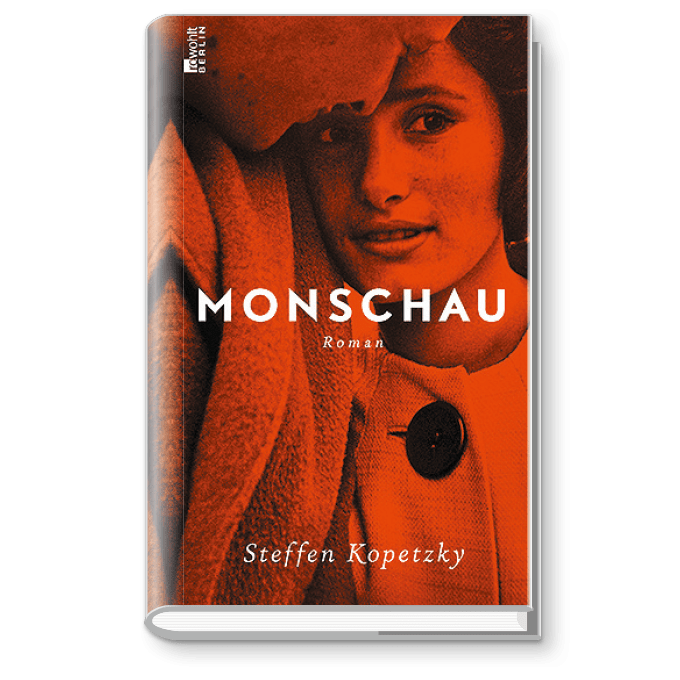Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich
 220 Lesepunkte sammeln
220 Lesepunkte sammeln
Hochaktuell und zeitlos zugleich: Steffen Kopetzky beeindruckt immer aufs Neue durch seinen Spürsinn für brisante Stoffe und durch filmreife Erzählkunst. Einerlei, ob er den großen Bogen bis zum anderen Ende der Welt spannt wie in seinem großen Erfolgsroman „Propaganda“ oder einen Hotspot in den Blick nimmt wie nun in „Monschau“ über die letzte Pockenepidemie in Deutschland 1962. Historische Fakten und fesselnde Fiktion – ein Abenteuerroman um die elementare Frage, wie man die Kontrolle über ein lebensbedrohliches Virus gewinnt. Und eine filmreife Geschichte über Liebe und Neuanfang!
Bei Ihrem Erfolgsroman „Propaganda“ brachte schon der Titel die Fülle an Themen perfekt auf den Punkt. Wofür steht der Titel Ihres neuen Romans „Monschau“?
Monschau ist eine alte Stadt etwas südlich von Aachen, also mitten in jener Herzregion Europas, die von Flamen, Luxemburgern und Deutschen besiedelt ist. Im Barock war „Montjoie“, wie es früher hieß, berühmt für sein Tuch, dessen Qualität mit dem besonders sauberen Wasser der in den Ardennen entspringenden Rur zu tun hat. Die Tuchfabrikanten hinterließen mit ihren Palästen ein reiches architektonisches Erbe – daher das Epitheton „Perle der Eifel“.
„Monschau“ liest sich stellenweise wie aus dem Hier und Jetzt, spielt aber in der Vergangenheit. Was war Ihr Ausgangspunkt?
Der Ausgangspunkt war die wahre Geschichte der letzten großen Pockenepidemie in Deutschland im Jahre 1962. Ich wusste schon lange von den Begebenheiten, weil eine Figur aus meinem Roman „Propaganda“ darin eine wichtige Rolle spielt. Durch Corona rückte mir Variola, so der lateinische Name des Pockenvirus, plötzlich vor Augen.
„Wie unter einem Vergrößerungsglas.“
Was macht den Eifel-Ort Monschau für Sie zum idealen, literarisch ergiebigen Hauptschauplatz?
Die barocke Tuchmacherstadt ist ein Kleinod inmitten der reichen Natur der Eifel. Durch die Vennbahn, eine Eisenbahnverbindung zwischen Aachen und Luxemburg, heute ein großartiger Radwanderweg, bekam das Monschauer Land aber auch schon früh Anschluss an die moderne Welt. Deshalb siedelte sich hier auch bald Industrie an, die ihre Produkte in alle Welt lieferte. Später war Monschau Aufmarschgebiet für die Ardennenoffensive und auch der Ort, an dem sie endgültig scheiterte. Wie unter einem Vergrößerungsglas kann man hier also deutsche, europäische und globale Geschichte zeigen.
Ihr Roman spielt im Jahr 1962. Welche Ereignisse, Entwicklungen und Persönlichkeiten prägten für Sie die Zeitstimmung?
1962 war ein bewegtes Jahr – nicht nur wegen der Hamburger Sturmflut. Das Wettrüsten erreichte einen ersten Höhepunkt, im Herbst folgte daraus die Kubakrise. 1962 war das letzte Jahr unter Adenauer, mit dem auch die Nachkriegszeit zu Ende ging. Günter Grass veröffentlichte „Katz und Maus“ und Friedrich Dürrenmatt fand mit „Die Physiker“ eine tragikomische Antwort auf die verzweifelte, vom Atomkrieg bedrohte Weltlage. Ostdeutschland hatte gerade viele Millionen in die Berliner Mauer investiert. Westdeutschlands Wirtschaft boomte, Arbeitskräfte fehlten und man begann, etwa mit der Türkei, sogenannte „Gastarbeiter-Abkommen“ zu schließen.
1962 sorgte Monschau für Schlagzeilen – und für den historischen Kern Ihres neuen Romans. Was machte die damalige Heimsuchung durch die Pocken für Sie zum literarischen Erreger?
Der Monteur eines ansässigen Industrieunternehmens hatte ein halbes Jahr lang Spezialöfen in Indien montiert und brachte die Pocken mit in die Eifel. Eine typisch deutsche Export-Erfolgsgeschichte drohte plötzlich in eine Katastrophe zu kippen.
„Im Mittelpunkt die jungen Liebenden!“
„Monschau“ ist weit mehr als eine Chronik der Pockenepidemie 1962. Welchem Schreibplan sind Sie gefolgt?
Dem eines klassischen Dramas. Ich habe mir dabei genau die Dramaturgie von Albert Camus‘ „Die Pest“ angesehen. Fünf Akte mit der Einheit von Raum und Zeit und einem überschaubaren Personal. Im Mittelpunkt die jungen Liebenden. Inspirierend war für mich auch ein kretischer Ritterroman aus dem frühen 17. Jahrhundert: der berühmte „Erotokritos“, der „von der Liebe geprüfte“ Held.
Welche Leitlinie hatten Sie beim Schreiben für die Verbindung der überlieferten Fakten mit literarischer Fiktion?
Ich habe mich bei meinem Setting der Epidemie genau an ihre Ursache, ihren Verlauf und ihr Ende gehalten, dann aber die meisten Figuren neu erfunden.
Eine zentrale, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle hat aber eine historische Gestalt: Prof. Dr. Günter Stüttgen. Was imponiert Ihnen an ihm – ob als Mensch / Persönlichkeit oder als Mediziner – am meisten?
Stüttgen kam mit Anfang Zwanzig von der Uni direkt als Sanitätsoffizier an die Westfront. Viele seiner Generation sind am Grauen des Krieges und seinen Verbrechen seelisch zugrunde gegangen, kehrten als Zombies zurück. Stüttgen hingegen hatte es vermocht, den Krieg hinter sich zu lassen, das Grauen zu überwinden und sein Leben der Verpflichtung des Arztberufes, der dermatologischen Forschung, aber auch, als Düsseldorfer nicht verwunderlich, der Kunst zu widmen. Über seine Taten im Krieg aber schwieg er. Es waren erst Militärhistoriker aus Pennsylvania, die in ihm den „German Doctor“ aus dem Hürtgenwald identifizierten, der 1944 vielen amerikanischen Soldaten das Leben gerettet hatte. Menschen wie Stüttgen – oder Helmut Schmidt, der nur einen Monat älter war, oder auch Joseph Beuys – prägten später das Westdeutschland der siebziger Jahre.
Dem medizinischen Leiter Prof. Stüttgen stellen Sie in Ihrem Roman einen 24-jährigen Assistenzarzt an die Seite: Nikos Spyridakis. Hat auch er ein Vorbild im wirklichen Leben?
Es gab tatsächlich einen jungen griechischen Arzt, aber Nikos ist eine frei erfundene Figur. Griechen waren mit die ersten ausländischen Studenten, die ihren Weg in der Nachkriegszeit nach Deutschland fanden. Viele von ihnen blieben und machten beachtliche Karrieren. Ich habe da einige Lebensgeschichten in die Figur von Nikos einfließen lassen.
„Viren, ihre Vielfalt, ihre Tricks …“
Sie gewähren anschauliche Einblicke in die Welt der Medizin und besonders der Virologie. Wie haben Sie Ihre Kenntnisse gewonnen?
Bei meiner Beschäftigung mit der Welt der Viren kam ich selber aus dem Staunen nicht heraus: So bedrohlich manche von ihnen für uns sind, stellen sie dennoch einen unentbehrlichen Baustein des Lebens auf unserer Erde dar. Ihre Vielfalt, ihre Tricks und Fortpflanzungsmethoden haben mich überwältigt – wie eine unbekannte Welt mitten um mich herum, die ich bislang nicht gesehen habe. Wie ein Tauchgang in eine neue, unendlich formenreiche Welt.
Sie schreiben, dass Nikos bei der Elektronenmikroskopie „beinahe kindliches Vergnügen“ hat. Was hat Sie selbst denn beim Schreiben am meisten fasziniert?
Faszinierend war eigentlich alles, aber besonderes Vergnügen empfand ich beim Schreiben des großen Karnevals-Kapitels. Da der Karneval heuer wie 1962 im Monschauer Land ja ausfällt, wollte ich für literarischen Ersatz sorgen und den rheinischen Karneval in seiner ganzen menschlich, allzu menschlichen Grandiosität feiern. Es hat Spaß gemacht, die lebenslustige Vera und den eher zurückhaltenden Nikos in das Getümmel eines echten rheinischen Kneipenkarnevals zu schicken. Gerade weil es ein halb-illegaler „Pocken-Karneval“ ist, so wie heute die „Corona-Partys“. Aber so ist der Mensch: Lust und Gefahr gleichermaßen suchend.
Die ersten Pockenfälle verweisen auf die Rither-Werke. Was macht die Konfliktlage besonders heikel?
Natürlich solll die Fabrik am Laufen gehalten werden. Gesundheitsschutz und ökonomische Interessen müssen zur Deckung gebracht werden. Nicht ganz einfach. Ganz wie heute.
„Ein Strich durch seine sinistren Pläne.“
Die Mediziner bekommen es mit einem nicht zu unterschätzenden Kontrahenten zu tun. Was verkörpert der sinistere Direktor Seuss für Sie?
Er ist einer der Männer, die damals im Wirtschaftswunderland Deutschland ihren Platz zwischen den alten Unternehmerfamilien und den Arbeitern einnahmen. Im Dritten Reich ein Wehrwirtschaftsführer, in der BRD dann ein global denkender Manager amerikanischer Prägung. Bislang war sein Leben ein einziger Aufstieg. Aber Variola und einiges andere machen ihm einen Strich durch seine, wie Sie ganz richtig sagen, sinistren Pläne.
1962 nähert sich das Ende der Nachkriegszeit und der Amtszeit von Adenauer. Aber der Geist – oder Ungeist – der Vergangenheit spukt noch immer, oder?
Ja. Zwar hatte es die Nürnberger Prozesse gegeben, aber da hatte man ja nur ein paar Dutzend der obersten Führung angeklagt. An unzähligen Stellen der Gesellschaft und des Staates aber saßen überall noch die Mittelbau-Nazis, in den Gerichten, den Staatsanwaltschaften, in den Ministerien, Behörden und in großer Zahl in der Industrie. Mit dem Eichmann-Prozess, der zur Zeit des Romans gerade zu Ende gegangen war, wurde endlich offenbar, wie viele in die Verbrechen des Dritten Reichs involviert gewesen waren. So viele hatten davon gewusst, doch die Gesellschaft schwieg. Die Studentenrevolte von 1968 wenige Jahre später entzündete sich genau daran. Ins Spiel bringen Sie auch die Firmenerbin der Rither-Werke. Welche Rolle haben Sie ihr zugedacht? Nun, Vera Rither ist eine junge, sehr starke Frau. Sie will mit dem Schweigen brechen und ihren eigenen Weg beschreiten. Und in Europa kamen die stärksten progressiven Impulse natürlich aus Paris, wo man mit Sartre, Simone de Beauvoir und anderen ein pulsierendes, revolutionär gesinntes, intellektuelles und künstlerisches Leben pflegte … Einen größeren Gegensatz zum beschaulichen Monschau konnte es kaum geben. Genau richtig für Vera Rither, die nach vielen persönlichen Tragödien ihren eigenen Weg beschreiten und die Vergangenheit hinter sich lassen will.
Welche Fragen haben Sie bei der Arbeit an „Monschau“ eigentlich am meisten interessiert?
Einen Aspekt fand ich, gerade mit Blick auf die gegenwärtige Pandemie-Lage, besonders spannend: den jahrhundertelangen Kampf der Menschheit gegen diese Krankheit, die schließlich Ende der 70er Jahre ausgerottet war. Möglich war das, weil man schon im 18. Jahrhundert eine erste Impfung hatte. Schon Goethe – selbst als Kind an den Pocken erkrankt – beschreibt, welch großen Widerstand es dennoch bereits zu seiner Zeit gegen das Impfen gab. Goethe war übrigens der erste Großschriftsteller, der jemals freimütig über seine eigene Erkrankung an den Pocken geschrieben hat.
„Monschau“ löst beides aus: Gänsehaut und Beklommenheit, aber auch Hoffnung. Wie erging es Ihnen beim Schreiben?
Ich wollte neben all den wichtigen Aspekten der Zeitgeschichte, des medizinischen Fortschritts und der gesellschaftlichen Veränderungen vor allem auch eine Geschichte von zwei Menschen erzählen, die sich während einer absoluten Ausnahmesituation kennenlernen und zueinanderfinden – eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund einer Epidemie. Das war mein Antrieb.