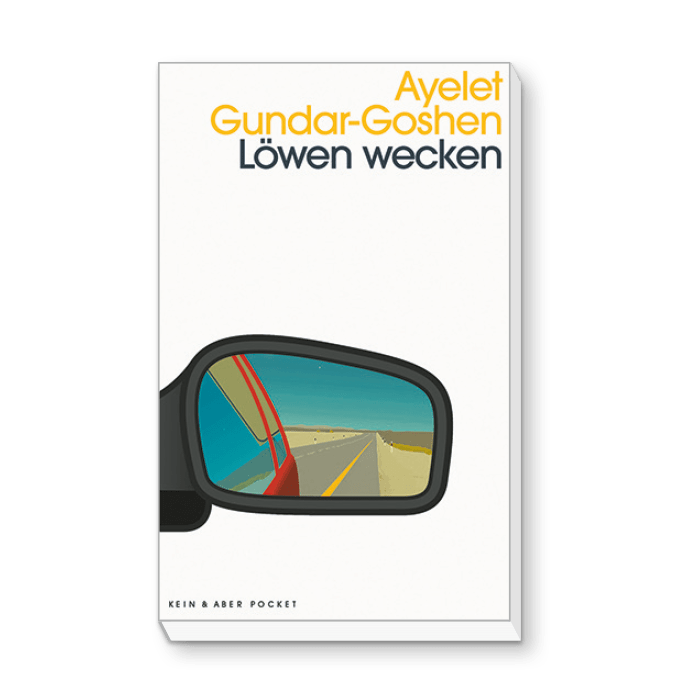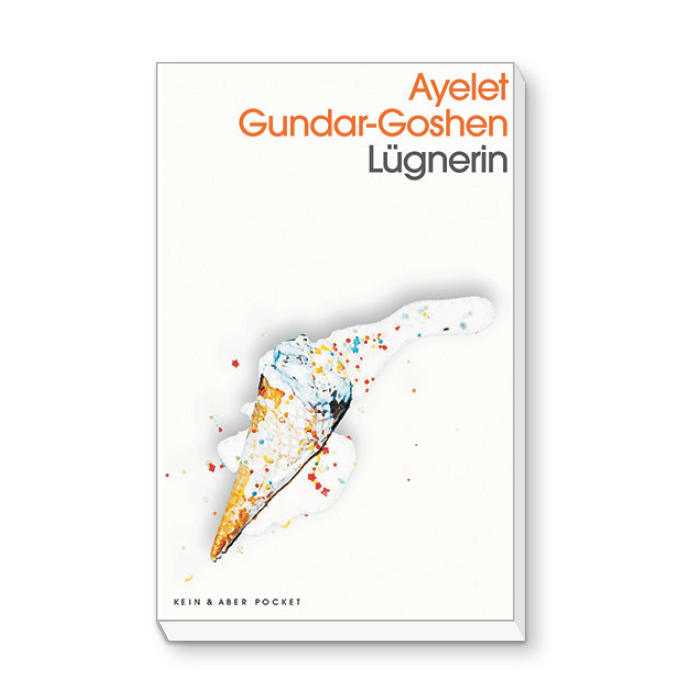©
© oc-gonzalez; unsplash.com
Die Hommage von Ruth Achlama, der Übersetzerin u.a. von Ayelet Gundar-Goshen, lesen Sie hier:
Unsere Empfehlung: Weitere, bereits als Taschenbücher erhältliche Romane von Ayelet Gundar-Goshen:
„Eine Nacht, Markowitz“
Kein & Aber Pocket
14,00 €
Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 140 Lesepunkte sammeln
140 Lesepunkte sammeln
„Löwen wecken“
Kein & Aber Pocket
14,00 €
Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 140 Lesepunkte sammeln
140 Lesepunkte sammeln
„Lügnerin“
Kein & Aber Pocket
14,00 €
Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich
 140 Lesepunkte sammeln
140 Lesepunkte sammeln